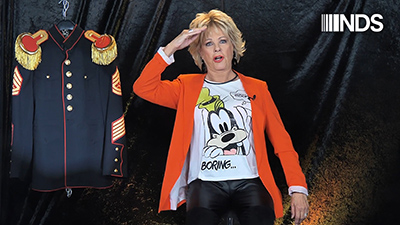Die Grundlagen des Stabilitäts- und Wachstumspakts: O heilige Dreifaltigkeit!
Die Reaktionen auf Sigmar Gabriels Forderung in der vorletzten Woche, den Krisenländern der EU im Gegenzug für Reformen etwas mehr Zeit zum Abbau ihrer Staatsdefizite zu geben, waren vorhersehbar: Während der Vorschlag in Frankreich und Italien Zustimmung erntete, stieß er in Deutschland auf eine breite Front der Ablehnung, von „Spiegel“, „FAZ“, „Die Welt“ bis hin zu „Focus“.[1] Von Günther Grunert [*]
Auch wenn sich Gabriel später um Klarstellung bemühte, dass damit natürlich nicht der Stabilitäts- und Wachstumspakt in Frage gestellt werden sollte, war die Empörung groß: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer etwa warnte den Bundeswirtschaftsminister davor, „mit den französischen Schuldensozis zu mauscheln“, der Bankenverband sah einen „Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten“ und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wandte sich gegen eine erneute Aufweichung des Stabilitätspakts. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sofort gemeinsam mit ihrem estnischen Kollegen Taavi Roivas fest: „Wir sind beide der Überzeugung, dass der Stabilitätspakt als einer der wichtigsten Teile der Überwindung der Eurokrise weiter in Kraft bleiben muss, dass er nicht geändert werden darf.“ Und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble beruhigte die Öffentlichkeit nach einer Zusammenkunft mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg: „Niemand hat eine Aufweichung des Stabilitätspaktes gefordert“ (FR, 21.6.2014).
Obwohl der Stabilitätspakt nach seiner Entstehung im Jahr 1997 keineswegs auf ungeteilte Zustimmung stieß, genießt er offenbar in der deutschen Öffentlichkeit inzwischen ein so hohes Ansehen, dass selbst eine eher unbedeutende Forderung wie die von Sigmar Gabriel, den Pakt etwas flexibler zu gestalten, sofort heftige Abwehrreaktionen auslöst.
Zur Erinnerung: Im sog. Stabilitäts- und Wachstumspakt verpflichten sich die EU-Länder zur Wahrung einer dauerhaften und nachhaltigen Haushaltsdisziplin auch nach Eintritt in die Währungsunion. Ein wesentliches Element dieses Pakts besteht darin, dass die EU-Staaten mittelfristig nahezu ausgeglichene öffentliche Haushalte (oder Überschüsse) anstreben müssen. Als Obergrenze für die jährlichen Haushaltsdefizite gilt dabei grundsätzlich die Marke von 3 Prozent des BIP, der Schuldenstand soll höchstens 60 Prozent des BIP betragen. Nur in festgelegten seltenen Ausnahmefällen sind höhere Defizite zugelassen.[2]
Wie aber kamen die Autoren des Vertrags von Maastricht auf diese Höchstwerte, die viele Politiker seither wie eine Monstranz vor sich hertragen und über deren Berechtigung in den hiesigen Medien kaum noch diskutiert wird? Dieser Frage wird in Abschnitt 2 dieses Beitrags nachgegangen. Abschnitt 1 soll zuvor noch einmal kurz die mit der 3-Prozent-Defizitgrenze verbundenen ökonomischen Probleme aufzeigen. Abschnitt 3 beendet mit einem Fazit die Analyse.
- Die Problematik der Haushaltsdefizit-Grenze von 3 Prozent
Die Schwächen der Defizitregel des Stabilitätspakts zeigen sich insbesondere bei einer ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung. So verringert ein starker negativer Nachfrageschock, der zu einem Konjunkturabschwung führt, die Steuereinnahmen und erhöht gleichzeitig die Sozialausgaben, so dass sich der Finanzierungssaldo des Staatssektors automatisch in Richtung Defizit (bzw. eines steigenden Defizits) bewegt, auch wenn weder die Staatsausgaben noch die Steuersätze durch politische Entscheidungen verändert werden.
Was oft nicht verstanden wird, ist, dass das Budgetergebnis in starkem Maße durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst wird und deshalb zu einem großen Teil außerhalb der Kontrolle des Staates liegt. Reduziert der Staat in einem ökonomischen Abschwung seine Ausgaben, um eine Überschreitung der 3-Prozent-Defizitgrenze zu vermeiden oder zu korrigieren, führt dies wegen der Rückkoppelungseffekte zu einer Verschärfung und Verlängerung der Rezession, was dann mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Verletzungen der Stabilitätsregeln (und dann nochmalige Ausgabenkürzungen) nach sich zieht.[3] Das gilt erst recht, wenn der Staat obendrein versucht, die automatischen Stabilisatoren (allen voran Renten- und Arbeitslosenversicherung) zu beschneiden, wie dies etwa in Südeuropa mit den Austeritätsvorschriften der Troika aus EU-Kommission, IWF und EZB durchgesetzt wurde. Eine solche prozyklische Politik wird von Mitchell/Muysken treffend als „fiskalischer Vandalismus“ (Mitchell/Muysken 2008, S. 142) bezeichnet.
Da das Budgetergebnis weitgehend endogen bestimmt wird, kann der Staat es nicht einfach vorab als Ziel festlegen, d.h. die Verwendung willkürlicher und rigider fiskalischer Regeln ist wenig sinnvoll. Brechen in einem konjunkturellen Abschwung die privaten Ausgaben ein und steigt damit das staatliche Defizit, so besteht die richtige Handlungsweise darin, die diskretionären Staatsausgaben zu erhöhen und nicht etwa zu kürzen. Denn der private Sektor (Unternehmen und Haushalte) reagiert auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in der Regel mit der Einschränkung seiner Ausgaben, ein Verhalten, das aus einzelwirtschaftlicher Sicht verständlich, gesamtwirtschaftlich aber schädlich ist, da es die Nachfrage schwächt und die Wirtschaft weiter nach unten treibt. Folglich muss der Staat in antizyklischer Weise intervenieren, indem er seine Ausgaben steigert und die Konjunktur stabilisiert.
Der grundlegende Fehler des Stabilitätspakts liegt in der Annahme, dass staatliche Budgetdefizite etwas prinzipiell Schlechtes sind, das es so weit wie möglich zu vermeiden gilt. In Wirklichkeit aber sind staatliche Haushaltsdefizite eines Landes weder gut noch schlecht, sondern zwingend erforderlich, wenn die geplanten Ausgaben des nichtstaatlichen Sektors – d.h. des privaten heimischen Sektors (Haushalte und Unternehmen) und des externen Sektors (Ausland) – nicht ausreichen, um die vollständige Nutzung der verfügbaren produktiven Ressourcen des Landes sicherzustellen.[4] Denn wenn die Ausgaben des privaten heimischen Sektors eines Landes dessen Einnahmen unterschreiten, private Haushalte und Unternehmen also zusammen genommen sparen, dann geht das aus Gründen der Logik nur dann mit nicht sinkendem Einkommen der Gesamtwirtschaft einher, wenn die beiden verbleibenden Sektoren, also Staat und Ausland, bereit sind, sich spiegelbildlich dazu zu verschulden. Dass die Verschuldung des Auslands auf Dauer aber keine Lösung ist, lehren die Eurokrise und die Diskussion um drohende Abwertungswettläufe zwischen den großen Weltwährungen. Bleibt also nur der Staat als Sektor übrig, den Sparwünschen der Privaten mit Verschuldungsbereitschaft zu begegnen, um das gesamtwirtschaftliche Einkommen zu stabilisieren (zu den Zusammenhängen zwischen den Finanzierungsüberschüssen resp. –defiziten der volkswirtschaftlichen Sektoren vgl. ausführlicher hier).
Möglicherweise liegt die Aversion gegen staatliche Budgetdefizite in weiten Teilen der Öffentlichkeit schon in der Begrifflichkeit, die sich vortrefflich für politische Zwecke missbrauchen lässt. Der Begriff „Defizit“ zeigt einen Fehlbetrag an, was zwar im buchhalterischen Sinne richtig, aber dennoch irreführend ist, da dies den positiven Beitrag eines staatlichen Haushaltsdefizits für die Bildung von Netto-Geldvermögen auf Seiten des nichtstaatlichen Sektors unterschlägt (Connors/Mitchell 2013). Tatsächlich sind Staatsdefizite die einzige Quelle des Netto-Geldvermögens des nichtstaatlichen Sektors. Denn alle Transaktionen zwischen den wirtschaftlichen Akteuren im nichtstaatlichen Sektor gleichen sich zu Null aus.[5]
- Zur Entstehung der Vorgaben des Stabilitätspakts
Wie bereits erwähnt, verlangt der Stabilitäts- und Wachstumspakt, dass die gesamten Schulden eines Staates nicht höher als 60 Prozent seines BIP sein dürfen; für das jährliche Defizit im Haushalt gilt eine Obergrenze von 3 Prozent des BIP. Dies wirft die Frage auf, warum gerade diese Referenzwerte gewählt wurden.
Tatsächlich weiß die herrschende Lehre trotz zahlloser Modelle und empirischer Untersuchungen so gut wie nichts über irgendeinen „optimalen“ Schuldenstand eines Landes (in Relation zum BIP). Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an die Reinhart/Rogoff-Studie vor einigen Jahren (Reinhart/Rogoff 2010). Die beiden Autoren glaubten herausgefunden zu haben, dass eine Staatsschuldenquote, die den Schwellenwert von 90 Prozent überschreite, das Wachstum signifikant verringere. Dieses Ergebnis wurde von Politik und Wissenschaft als (längst überfälliger) Durchbruch in der Forschung zur Tragfähigkeit staatlicher Schulden gefeiert, bis sich herausstellte, dass die behauptete 90-Prozent-Schwelle schlicht das Resultat peinlicher Rechenfehler war.
Was also tun? Die Verfasser des Vertrags von Maastricht entschieden sich für eine pragmatische Lösung: Der Schuldenstand lag im Durchschnitt aller EU-Länder im Jahr 1990 bei 60,2 Prozent, also orientierte man sich einfach an dieser Zahl und legte eine 60-Prozent-Grenze für den Schuldenstand fest, ohne zu wissen, ob diese Verschuldungsquote zu hoch, zu niedrig oder vielleicht zufällig richtig, ja, ob eine solche Quote überhaupt in irgendeiner Weise ökonomisch relevant war (vgl. auch Bofinger 2005, S. 92).
Noch willkürlicher entstand die Haushaltsdefizitgrenze von 3 Prozent. Zunächst wurde noch vermutet (vgl. z.B. Bofinger 2005, S. 92), dass die Höchstmarke von 3 Prozent des BIP für die jährliche Neuverschuldung deshalb gewählt wurde, weil damit bei einer unterstellten Wachstumsrate des nominalen BIP von 5 Prozent der öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zum BIP über die Zeit konstant bei 60 Prozent gehalten werden könnte.[6]
Jedoch stammt die Idee einer Defizitgrenze von 3 Prozent – wie sich erst viel später herausstellte (vgl. hier, hier und hier) – ursprünglich aus Frankreich. Das Haushaltsdefizit war dort im Jahr 1981 auf etwa 55 Mrd. Francs angewachsen und Prognosen für das Jahr 1982 gingen von einem weiteren Anstieg auf über 100 Mrd. Francs aus. Der im Mai 1981 neu gewählte Präsident Francois Mitterrand beauftragte daraufhin den damaligen stellvertretenden Leiter der Budgetabteilung im Finanzministerium, Pierre Bilger, eine einfache, praktische Defizitregel zu den Grenzen der jährlichen Neuverschuldung zu finden. Bilger gab den Auftrag an einige Ökonomen mit angeblich großem mathematischen Sachverstand weiter, unter ihnen Guy Abeille, der als Projektmanager im französischen Finanzministerium arbeitete. Abeille verriet in den Jahren 2010 und 2012 der Öffentlichkeit, wie die Haushaltsdefizit-Grenze von 3 Prozent des BIP zustande gekommen war. Seine Version wurde von wichtigen damaligen Entscheidungsträgern wie Ex-Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer und dem späteren EZB-Chef Jean-Claude Trichet im Wesentlichen bestätigt.
In einem Interview von 2012 berichtet Abeille: „Wir dachten uns die 3%-Zahl in weniger als einer Stunde aus, es war eine Berechnung auf die Schnelle, ohne jede theoretische Überlegung. … Mitterrand wollte, dass wir ihm rasch eine einfache Regel lieferten, die ökonomisch klang und die er den Ministern, die in sein Büro marschierten und um mehr Geld baten, entgegenhalten konnte. … Wir brauchten etwas Einfaches. … 3%? Das war eine gute Zahl, eine Zahl, die die Zeit überdauert hat; sie erinnerte an die Dreifaltigkeit“ (Le Parisien 2012; zitiert und übersetzt nach Mitchell 2014).
Statt hoher Mathematik also eher Religion (Dreifaltigkeit), was dann wieder gut zu dem religiösen Eifer passt, mit dem fortan auf die Einhaltung dieser völlig aus der Luft gegriffenen Defizitregel gepocht wurde.
Das 3-Prozent-Kriterium wurde zunächst von Mitterrand in einer Richtlinie vom 9. Juni 1982 aufgegriffen („Die Obergrenze liegt bei 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes – nicht mehr“) und fast zehn Jahre später von Jean-Claude Trichet, dem damaligen Leiter des französischen Schatzamtes und späteren Präsidenten der EZB, in den festgefahrenen europäischen Verhandlungen kurz vor Beginn der Maastricht-Konferenz Ende 1991 als Vorschlag Frankreichs in die Diskussion eingebracht. Die deutsche Seite stimmte der französischen 3-Prozent-Idee schon nach relativ kurzer Zeit zu und so fand sie schließlich ihren Weg in den im Jahre 1997 geschlossenen Stabilitäts- und Wachstumspakt.
- Fazit
Es ist grotesk und deprimierend zugleich: Zwei reine Phantasiezahlen ohne jede ökonomische Fundierung schränken in Europa den Handlungsspielraum der nationalen Fiskalpolitiken massiv ein und zwingen die Euro-Krisenländer zu einer destruktiven prozyklischen Politik, mit verheerenden Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in diesen Ländern.
Auch wenn es falsch ist, den Stabilitäts- und Wachstumspakt allein für die ökonomische Misere im Euroraum verantwortlich zu machen (die eigentlichen Ursachen liegen vielmehr – wie schon oft erwähnt – in den hohen Leistungsbilanzungleichgewichten in der EWU, zu denen Deutschland maßgeblich beigetragen hat), so hat doch die auf dem Stabilitätspakt basierende restriktive Fiskalpolitik, die den Euro-Krisenländern von der Troika verordnet wurde, in einem stark rezessiven Umfeld die wirtschaftliche Lage noch einmal deutlich verschlechtert. (Dass die Drosselung von Löhnen und Gehältern im öffentlichen Dienst den Niedergang der Löhne in der Privatwirtschaft durch ihren „Vorbildcharakter“ gefördert und damit die Destabilisierung des Privatsektors auch von dieser Seite mit vorangetrieben hat, liegt auf der Hand und dürfte der fiskalischen Restriktion in der negativen Wirkung nicht nachstehen.) Trotzdem sollen sich – wenn es nach dem Willen der Stabilitätspakt-Befürworter geht – auch in Zukunft die nationalen Fiskalpolitiken strikt an einem Regelwerk orientieren, das quasi über Nacht zusammengeschustert wurde und das jeglicher theoretischer Grundlage entbehrt.
Literatur
- Bofinger, P. (2005): Wir sind besser, als wir glauben, München
- Connors, L./Mitchell, W. (2013): Framing Modern Monetary Theory, in: Centre of Full Employment and Equity [PDF – 681 KB], Working Paper No. 06-13, November; letzter Zugriff: 29.6.2014
- Le Parisien (2012): 3% de déficit: “Le chiffre est né sur un coin de table”, 28. September
- Minsky, H. P. (1986): Stabilizing an Unstable Economy, New Haven and London
- Minsky, H. P. (1992): Yes, There is a Democratic Economics, Hyman P. Minsky Archive, Paper 191; letzter Zugriff: 29.6.2014
- Mitchell, B. (2014): Options for Europe – Part 40; letzter Zugriff: 29.6.2014
- Mitchell, W./Muysken, J. (2008): Full Employment Abandoned – Shifting Sands and Policy Failures, Cheltenham
- Reinhart, C./Rogoff, K. (2010): Growth in a Time of Debt [PDF – 230 KB], in: NBER Working Paper 15639, Cambridge, January; letzter Zugriff: 29.6.2014
- Stützel, W. (1978): Ober- und Untergrenzen der öffentlichen Verschuldung, in: Kredit und Kapital, 11. Jahrgang, S. 429-449
[«*] Grunert, Günther, Dr., geb. 1955, ist an den Berufsbildenden Schulen der Stadt Osnabrück am Pottgraben vor allem im Bereich Berufs- und Fachoberschule Wirtschaft tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Makroökonomie, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Arbeitsmarkt.
[«1] Ein herzlicher Dank für wertvolle Anmerkungen zu diesem Beitrag geht wiederum an Friederike Spiecker.
[«2] Eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts vom 13.12.2011 soll gewährleisten, dass – wie es das deutsche Bundesfinanzministerium ausdrückt – „mehr Budgetdisziplin nicht nur gefordert, sondern auch tatsächlich durchgesetzt wird.“
[«3] Es entsteht so die Gefahr eines ökonomischen Teufelskreises von staatlichen Ausgabenkürzungen, abnehmendem Wachstum, zunehmender Arbeitslosigkeit, sinkenden Steuereinnahmen, wachsenden Sozialausgaben, damit steigenden Budgetdefiziten und neuen staatlichen Sparprogrammen etc.
[«4] Genau dies aber – nämlich die Nutzung aller verfügbaren Ressourcen und nicht etwa die Erreichung irgendwelcher festgelegter Defizitziele – kennzeichnet eine erfolgreiche Wirtschaft: „A successful economy fully uses its resources and creates resources. It achieves and sustains a close approximation to full employment. Its ability to produce grows as a by product to sustained full employment” (Minsky 1992, S. 9).
[«5] Wenn der nichtstaatliche Sektor also netto sparen (d.h. in einer Periode weniger ausgeben als einnehmen, also einen Einnahmenüberschuss erzielen) möchte, muss der Staat ein Budgetdefizit verzeichnen: Das staatliche Defizit ist immer gleich dem nichtstaatlichen Überschuss.
Bedeutende frühere Ökonomen hatten diesen Zusammenhang immer im Blick (anders als viele heutige Mainstream-Ökonomen, die ihn schlicht ignorieren), so beispielsweise Wolfgang Stützel in Deutschland: „Gibt der Fiskus in der Bundesrepublik in einem Jahr, wie z.B. 1976, 42 Milliarden Deutsche Mark mehr aus als er selbst an Steuern einnimmt, dann haben die übrigen Wirtschaftssubjekte in der Welt genau denselben Betrag an Gehältern, Zinsen oder Liefererlösen mehr eingenommen als sie in der gleichen Zeit selbst ausgaben. Anders gewendet: Indem der deutsche Staat 42 Milliarden DM Ausgabenüberschüsse tätigt, haben dadurch zwangsläufig die übrigen Sektoren in der Welt 42 Milliarden DM Einnahmeüberschüsse“ (Stützel 1978, S. 444f). Ähnlich Hyman Minsky in den USA: „A fundamental proposition in economics is that the sum of realized financial surpluses (+) and deficits (-) over all units must equal zero. This follows from the simple point that every time some unit pays money for the purchase of current output, some other unit receives money. Because the different sectors of the economy (e.g., households, business firms, government, and financial institutions) are consolidations of elementary units, this proposition also holds for the various aggregations. If the federal government spends $73.4 billion more than it collects in taxes, as it did in 1975, then the sum of the surpluses and deficits over all other sectors equals $73.4 billion surplus” (Minsky 1986, S. 26f).
[«6] Dazu ein einfaches Zahlenbeispiel, das auch Bofinger (2005, S. 92f) bringt: Ein Land habe im Ausgangsjahr staatliche Schulden in Höhe von 60 Euro und ein nominales BIP von 100 Euro. Der öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zum BIP beträgt damit 60 Prozent. Das nominale BIP steige nun im Folgejahr um 5 Prozent (also 5 Euro) auf 105 Euro. Gleichzeitig betrage die neu aufgenommene Verschuldung im Folgejahr 3 Prozent des BIP, also 3 Euro. Damit wächst der Schuldenstand auf 63 Euro (60 + 3). Die Relation des Schuldenstandes zum BIP bleibt damit konstant bei 60 Prozent (63/105 = 60 Prozent).