Während der Niedrigzinsphase der letzten Jahre ist es um die Zinskritik ruhig geworden. Kaum sind die Zinsen wieder gestiegen, feiern die alten „Argumente“ der Zinskritiker jedoch offenbar ihre Wiedergeburt. Das ist zumindest der Eindruck, den wir aus einigen Leserzuschriften gewinnen konnten. Wir selbst hatten uns zuletzt vor mehr als zehn Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Da wir seitdem sehr viele neue Leser gewinnen konnten und viele von ihnen sicher nicht im Thema sind, möchten wir Ihnen heute zwei ältere Artikel vorstellen, die sich mit den „Argumenten“ der Zinskritiker beschäftigen und sie im Kern widerlegen. Von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Kritik an der Zinskritik
Erschienen am 23. August 2011
Die Folgen der Finanzkrise haben auch dazu geführt, dass Fundamentalkritik am Geldsystem immer populärer wird. Auch die NachDenkSeiten bekommen regelmäßig Mails von Lesern, die uns fragen, warum wir der Zinskritik auf unserer Plattform keinen Raum bieten. Die Antwort auf diese Frage ist denkbar einfach: Wir halten die Zinskritik für einen Irrweg, der nur von den eigentlichen Problemen ablenkt.
Der Zins, so liest man auf einigen Internetseiten, sei der Konstruktionsfehler, ja geradezu die „Erbsünde“ unseres Geld- und Finanzsystems. Er sorge nicht nur dafür, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, sondern führe auch ganz direkt zu einem exponentiellen Wachstumszwang der Geldmenge und zur Zinsknechtschaft der Bevölkerung. Finanz- und Wirtschaftskrisen seien somit die direkte Folge des Zinssystems. Diese Kritik ist nicht neu. Seitdem Geld gegen Zins verliehen wird, gibt es auch Kritik am Zins. Diese Kritik war und ist jedoch meist keine ökonomische Kritik, sondern vielmehr eine Kritik an der ungleichen Verteilung des Vermögens und der Macht der Vermögenden, oft durchmischt mit einem religiösen, völkischen, ja antisemitischen Grundton.
Zins aus Sicht des Kreditnehmers
Um die Kritik am Zins einordnen zu können, muss man sich zunächst vergegenwärtigen, was Zins überhaupt ist. Hierbei muss man auf Seiten der Kreditnehmer zwei Gruppen unterscheiden. Unternehmen nutzen Kredite meist dazu, Investitionen vorzunehmen, mit deren Hilfe sie bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielen. Der Zins ist aus Sicht dieser Kreditnehmer eine Prämie dafür, mit Hilfe von Fremdkapital Investitionen vorzunehmen, um die eigene Ertragssituation zu steigern. Privatleute ziehen mit Hilfe von Krediten meist Ausgaben vor, die ihnen einen wie auch immer gearteten Nutzen versprechen – sei es das neue Auto, für das man momentan noch nicht genug Geld hat oder das Eigenheim. Die Alternative zum Kredit ist das klassische Sparen.
Wer beispielsweise ein Haus bauen will, hat zwei Möglichkeiten – entweder er spart und kauft sich das Haus, wenn er den nötigen Kapitalstock zusammengespart hat, oder er nimmt einen Kredit auf, mit dem er seine Investition vorzieht. „Kaufe jetzt, zahle später“. Für viele Privatleute ist die Kreditfinanzierung dabei die einzig realistische Variante, will man sein Eigenheim nicht erst mit Beginn des Rentenalters beziehen. Die Abzahlung einer Hypothek erstreckt sich häufig über einen Zeitraum von 28 Jahren. Natürlich ist das Vorziehen dieser Investition nicht kostenlos, ansonsten gäbe es wohl niemanden, der sein Geld über einen langen Zeitraum für eine solche Investition bereitstellt. Für die Möglichkeit, sein Eigenheim bereits zu nutzen, lange bevor man es komplett bezahlt hat, muss man – ebenso wie der Unternehmer – einen Preis bezahlen. Diese Prämie ist jedoch keine „Zinsknechtschaft“, sondern die freiwillig entrichtete Zahlung für die den gewonnenen (vorgezogenen) Nutzen. Wer den Zins verbieten will und den Menschen somit die Möglichkeit auf einen Kredit nehmen will, nimmt ihnen auch die Möglichkeit, Investitionen, die ihnen sinnvoll erscheinen, zeitlich vorzuziehen. Der Besitz eines Eigenheims wäre somit de facto ein Privileg für Erben und Spitzenverdiener – ein Zusammenhang, der von Zinskritikern gerne verschwiegen wird.
Zins aus Sicht des Kreditgebers
Für den Kreditgeber stellt der Zins nicht nur einen Inflationsausgleich, sondern vor allem eine Risikoprämie und schlichtweg den Preis für das Warten dar. Sicherlich würde jeder Bürger seinen eigenen Kindern einen zinslosen Kredit geben, wenn sie dringend Geld bräuchten. Die „Bonität“ und damit das Risiko, das Geld nicht in voller Höhe zurück zu erhalten, sind dabei zweitrangig. Wer aber würde einem Unbekannten zinsfrei Geld leihen, ohne zu wissen, ob man das Geld auch wiederbekommt? Zum Wesen des Kredits gehört nun einmal auch der Kreditausfall. Die Investition des Unternehmers kann sich als unrentabel herausstellen, der Häuslebauer kann seinen Job verlieren und den Kredit für das Eigenheim nicht mehr zurückzahlen können. Beide Fälle sind keine Ausnahmen, sondern Berechnungsgrundlage des Zinses.
Es ist vollkommen normal, dass ein Teil der Kredite nicht bedient werden kann. Um diese Ausfälle zu kompensieren, erhebt der Kreditgeber daher einen risikoabhängigen Aufschlag, der die Zinshöhe mitbestimmt. Gäbe es nur einen Einheitszins oder gar keinen Zins, würde wohl niemand sein Geld an ein ertragsschwaches Unternehmen oder eine Person mit Zahlungsschwierigkeiten verleihen.
Irrtümer der Zinskritiker
Die meisten Argumente und Anekdoten, die von Seiten der Zinskritiker kommen, fallen bei näherer Betrachtung wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Sehr beliebt ist beispielsweise die Anekdote vom „Jesuspfennig“ bzw. „Josephspfennig“. In dieser Anekdote, die auf den englischen Moralphilosophen Richard Price zurückgeht, legt Joseph für seinen Sohn Jesus einen Penny bei der Bank an. Durch Zins und Zinseszins wächst das Konto über die folgenden Jahre natürlich bis ins Unermessliche – eine Exponentialfunktion wie aus dem Lehrbuch. Diese Anekdote mag unterhaltsam sein, ökonomisch betrachtet ist sie blanker Unfug. Beim „Josephspfennig“ gibt es kein Risiko, keine politischen und wirtschaftlichen Krisen und keine Geldreformen. In der Realität wäre zumindest ein Teil des verliehenen Geldes durch Kreditausfälle „vernichtet“ worden und was noch übrigbliebe, wäre teilweise durch Inflation, Währungsreformen oder politische Verwerfungen entwertet oder umverteilt worden. Und wenn die Nachkommen Jesu´ gesetzestreue Bürger gewesen wären, hätten sie auf ihre Zinserträge selbstverständlich auch Steuern zahlen müssen. Die Geschichte vom „Josephspfennig“ ist eben dies – eine Geschichte, nicht mehr und auch nicht weniger.
Ein weiteres beliebtes „Argument“ der Zinskritiker ist, dass der Zins zu einer exponentiellen Steigerung der Geldmenge führt. Dabei wird unterstellt, dass die durch Kredit geschöpfte Geldmenge zwar nach der Tilgung wieder verschwindet, der Zins aber in der Welt bleibt und da Geld bekanntlich über Kredite geschöpft wird, nur über neue Kredite bedient werden kann. So einfach und so populär dieser Gedanke ist, so falsch ist er auch, da er gleich zwei elementare Faktoren unterschlägt. Die Geldmenge, die zur Bedienung der Zinsen benötigt wird, muss nicht geschöpft werden – sie ist vielmehr bereits vorhanden. Die Zinskritiker gehen implizit davon aus, dass die kreditvergebenden Banken die Zinseinnahmen horten. Das ist aber nicht der Fall. Ein Teil der Zinseinahmen fließt zum Beispiel in die Löhne und Gehälter der Bankmitarbeiter, ein Teil landet auf den Sparbüchern der Sparer, die der Bank ihr Eigenkapital zur Verfügung stellen, ein weiterer Teil fließt als Steuern an den Staat und die Gewinne werden entweder als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet oder reinvestiert. Aus volkswirtschaftlicher Sicht kreist das Geld – die Zinskosten des Kreditnehmers werden somit aus dem regulären Geldkreislauf gedeckt. Es besteht keine Notwendigkeit, Zinsen und Zinseszinsen durch immer neue Kredite zu bedienen und die Geldmenge bleibt durch den Zins weitestgehend unberührt.
Wachstumszwang?
Ein weiterer populärer Irrtum der Zinskritiker besagt, dass Zinsen zu einem „Wachstumszwang“ führen und die Wirtschaft „unnatürlich“ aufblähen. Der Denkfehler hinter dieser Annahme lässt sich bereits mit einem oberflächlichen Blick auf die Zinspolitik der Notenbanken ausräumen. Nicht hohe, sondern niedrige Zinsen kurbeln die Konjunktur an. Wenn eine Notenbank den Leitzins senkt, werden vermehrt Kredite nachgefragt, was nicht nur die Geldmenge, sondern auch die Investitionssummen steigen lässt. Erhöht eine Notenbank den Leitzins, wirkt dies wie eine Konjunkturbremse.
Während die genannten Irrtümer lediglich auf simplen Denkfehlern beruhen, werden bei anderen Fragen munter Ursache und Wirkung vertauscht und Kausalitäten unterstellt, die bei näherer Betrachtung nicht vorhanden sind. So wird beispielsweise die Umverteilung von unten nach oben und die damit verbundene Vermögenskonzentration von den Zinskritikern ursächlich dem Zins zugeschrieben. Eine kausale Erklärung für diese korrekt beobachtete Entwicklung liefern die Zinskritiker jedoch nicht. Empirisch lässt sich der Zusammenhang von Zins und Vermögenskonzentration jedoch relativ einfach widerlegen, wenn man sich die Periode von 1945 bis 1980 anschaut. Diese Periode wird auch als „große Kompression“ bezeichnet und zeichnete sich dadurch aus, dass sich nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensschere in allen westlichen Industrieländern immer weiter geschlossen hat. Während dieser Periode hat sich jedoch kaum etwas am Geld- oder Zinssystem verändert. Was diese Periode auszeichnete, war vielmehr ein klares Bekenntnis seitens der Politik, mittels Gesetzen und des Steuersystems für eine Angleichung der Lebensverhältnisse zu sorgen.
Erst die neoliberale Politik, die von Reagan und Thatcher in den 80ern eingeführt und in den Folgejahren von fast allen westlichen Industrieländern kopiert wurde, führte zum Ende der „großen Kompression“ und zur erneuten Öffnung der Einkommens- und Vermögensschere. Am Geld- und Zinssystem hat sich jedoch seit Beginn der neoliberalen Ära ebenfalls relativ wenig verändert. Der Zins war immer da, die Einkommens- und Vermögensentwicklungen, die zur heutigen Konzentration am oberen Ende geführt haben, sind eine direkte Folge der neoliberalen Politik – vor allem der Steuerpolitik. Wer sich einmal die Entwicklung des Spitzensteuersatzes in den Vereinigten Staaten vor Auge führt, findet die Erklärung, warum sich die Einkommens- und Vermögensschere seit 1980 öffnet, von ganz allein. Um diese Entwicklung zu analysieren, braucht man keine Zinskritik – es reicht der gesunde Menschenverstand.
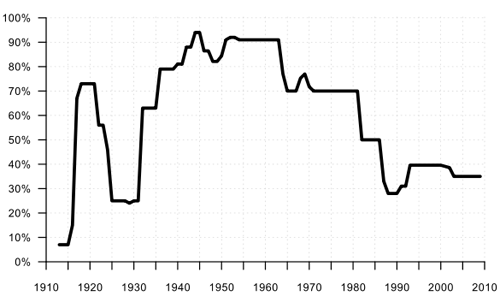
Abbildung: Spitzensteuersatz in den USA – Quelle: Wikimedia Commons
Verunglimpfung der Kritiker
Wer die Zinskritik kritisiert, wird von den Vertretern dieser Ideologie gerne in einen Topf mit den Verteidigern des momentanen Banken- und Finanzsystems geworfen. Ganz nach dem Motto: Wer den Zins nicht kritisiert, heißt damit automatisch den Casino-Kapitalismus gut. Nichts könnte falscher sein. Das globale Finanzcasino nutzt zwar Zinseffekte und Kredite bei seinen Spekulationen – Zins und Kredit sind jedoch auch für jeden Häuslebauer, für seriöse Wirtschaftsunternehmen und Kleinsparer wichtig. Wer das Finanzcasino durch ein Zinsverbot schließen will, bekämpft damit ein Symptom aber nicht die Krankheit. Es gibt viele Mittel und Wege, Spekulationen zu unterbinden und die Banken wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zuzuführen – ein Zinsverbot gehört jedoch ganz sicher nicht dazu.
Eine Hauptursache der Finanzkrise liegt übrigens in einem Denkfehler, den die Zinskritiker und die Finanzalchimisten der großen Investmentbanken teilen. Geradeso als hätten die Zinskritiker mit ihrer Geschichte vom „Josephspfennig“ doch recht, versuchten die Mathematiker der Investmentbanken, synthetische Papiere zu entwickeln, die einen risikolosen Zinsertrag versprechen sollten. Risiko und Zins lassen sich jedoch nicht trennen, mit „mündelsicheren“ Kreditverbriefungen kann man trotz AAA-Ratings keine garantierte Traumrendite erzielen. Um diese bittere Erfahrung zu machen, rissen die Finanzalchimisten das gesamte Finanzsystem in eine der schwersten Krisen seit Menschengedenken.
Stellungnahme zum Artikel „Kritik an der Zinskritik“
Erschienen am 7. September 2011
Wie kaum anders zu erwarten, hat der Artikel „Kritik an der Zinskritik“ bei einigen unserer Leser hohe Wellen geschlagen. Auf viele Mails bin ich direkt eingegangen, leider fehlt mir jedoch die Zeit, jede Mail einzeln zu beantworten. Daher habe ich mich entschlossen, noch einmal auf die am häufigsten genannten Punkte einzugehen. Von Jens Berger.
Charakter des Zinses
Aus vielen Mails geht hervor, dass der Zins immer noch oft als etwas „mystisches“ gesehen wird, das sich der konkreten Betrachtung entzieht. Dem ist nicht so. Pragmatisch gesehen ist der Zins nichts anderes als eine Gebühr, deren Höhe sich an bestimmten Faktoren ausrichtet. In diesem Punkt unterscheidet er sich kaum von der Miete (auch Mietzins genannt) oder der Leihgebühr für ein Auto. Auch bei der Miete zahlt man demjenigen, der einem etwas für einen bestimmten Zeitraum überlässt, eine zuvor ausgehandelte Gebühr. Niemand käme auf die Idee, Vermietern zu unterstellen, sie würden die Mieteinnahmen nicht dem Wirtschaftskreislauf hinzufügen. Es käme auch niemand auf die Idee, dass die Miete nicht aus dem eigenen Geld gezahlt werden kann, sondern zwingend zur Verschuldung führt. Warum sollte das beim Kredit anders aussehen als bei der Miete? Immer wieder taucht in den Lesermails die Vorstellung auf, dass der Zinsabtrag entweder durch neue Kredite finanziert werden müsse oder aber vom Kreditgeber dem Wirtschaftskreislauf entzogen würde. Beides ist jedoch bei näherer Betrachtung nicht haltbar. (Siehe weiter unten.)
Zinseszins
In vielen Mails wurde mir der Vorwurf gemacht, ich sei in meinem Artikel nicht hinreichend auf das „Problem des Zinseszinses“ eingegangen. Dieses „Problem“ ist jedoch nur dann ein „Problem“, wenn man sich die Argumentationsmuster der Zinseszinskritiker zu eigen macht. Auf Seite des Kreditgebers ließe sich nur dann eine relevanter Zinseszinseffekt erzielen, wenn man bestimmte Faktoren wie das Ausfallrisiko, die Inflation und die Steuern komplett ausblendet und ferner unterstelle, dass der Kreditgeber, bzw. der Sparer, nie Kapital aus seinem Kreditvolumen abzieht. Das wäre dann ein Pendant zum „Josephspfennig“, auf den ich schon in meinem Artikel ausführlich eingegangen bin. Die Zins- bzw. Zinseszinskritiker blenden hierbei elegant den Faktor „Risiko“ aus. Ist ein Kreditgeber risikoscheu, liegt sein Zinsgewinn ohnehin nur knapp über der Inflation, weshalb sich auch kein nennenswerter Zinseszinseffekt einstellen kann. Ist er risikofreudig, liegen seine Zinsgewinne im Erfolgsfall zwar weit über der Inflation – die Ausfallwahrscheinlichkeit ist jedoch ebenfalls erheblich größer, weshalb es hier unredlich wäre, dieses Risiko ganz einfach bei Seite zu wischen.
Noch geringer ist der Zusammenhang mit dem Zinseszins auf Seite des Kreditnehmers. Nur wenn man in die argumentative Trickkiste greift und unterstellt, dass Kredite a) nicht zurückgezahlt werden und b) die Zinskosten über neue Kredite bedient werden, die c) ebenfalls nicht zurückgezahlt werden, kommt überhaupt erst in die Gelegenheit, aus Seite des Kreditnehmers so etwas wie einen Zinseszins auszumachen. Für eine unterstellte „Gesetzmäßigkeit“ sind dies jedoch zu viele und vor allem zu realitätsferne Annahmen.
Horten
In vielen Antworten und Kommentaren zum meinem Artikel kam immer wieder das Argument vor, Geld, das nicht ausgegeben, sondern gespart würde, würde „gehortet“ und damit der Volkswirtschaft entzogen. Dieses Argument lässt sich bereits bei der Betrachtung der regulären Kreditvergabe widerlegen. Es ist zwar richtig, dass Banken ihre Kredite nicht ausschließlich aus den Kundeneinlagen vergeben – wenn man sich die Statistiken der Bundesbank [PDF – 25 KB] anschaut, erkennt man jedoch, dass der Kreditsumme von 3.963 Milliarden Euro, die der deutsche Bankensektor an den Privat- und Unternehmenssektor vergeben hat, immerhin 3.206 Milliarden Euro an Einlagen aus diesen beiden Sektoren gegenüberstehen.
So berechtigt die Kritik an den zu laschen Mindestreserve- und Mindesteigenkapitalanforderungen auch sein mag – ein Blick auf die Zahlen der Bundesbank zeigt, dass auch heute noch die Kreditvergabe im Wesentlichen aus den Einlagen der Bankkunden vorgenommen wird. Wer seine Ersparnisse also nicht unter dem Kopfkissen versteckt, „hortet“ sie auch nicht, sondern stellt sie – indirekt über den Bankensektor – Kreditnehmern und somit der Volkswirtschaft zur Verfügung.
Geld versus Vermögen
Sehr viele Einwände der Kritiker beruhen auf dem simplen Denkfehler, Geld und Vermögen gleichzusetzen. So wird oftmals die Geldmenge fälschlicherweise mit dem Volksvermögen gleichgesetzt. Dieser Denkfehler lässt sich jedoch mit einem simplen Beispiel widerlegen. Wer ein komplett abgezahltes und nicht belastetes Haus besitzt, ist zweifelsohne im Besitz eines Vermögensgegenstands. Dieses Haus findet sich jedoch in keiner Geldmengenberechnung wieder – es ist für die Notenbanken schlichtweg nicht existent. Erst wenn man dieses Haus beispielsweise als Sicherheit für einen Hypothekenkredit belastet, taucht sein Wert plötzlich auch in der Geldmengenstatistik auf. Am nächsten Tag ist dann die Geldmenge um den Betrag dieses Kredites gewachsen. Selbstverständlich hat diese Transaktion jedoch nichts am Vermögen geändert.
Umlaufgebühr
Einige Leser, die offensichtlich Anhänger der „Freiwirtschaft“ sind, wiesen mich darauf hin, dass nicht der Zins, sondern die positive Zinsrate „das Problem“ sei. Abhilfe würde demnach eine Umlaufgebühr schaffen, die das „Horten“ von Geld durch eine periodische Abwertung bestraft.
Ich gebe gerne zu, dass ich derlei Argumentation noch nicht einmal im Ansatz nachvollziehen kann. Worin besteht der Unterschied einer solchen Umlaufsicherung zu der vorhandenen Inflation? Warum soll eine Umlaufsicherung die Menschen davon abhalten, Geld zu „horten“? Wer sein Geld dem Kreislauf entzieht, muss auch heute mit einer Entwertung dieses Geldes rechnen – nur halt nicht absolut, sondern relativ. In die gleiche Kategorie sind Leseranmerkungen einzuordnen, die den Zins deshalb verbieten wollen, weil eine konstante Geldmenge und ein konstanter Wert des Geldes anzustreben sei. Warum sollte so etwas anzustreben sein? Wenn eine konstante Geldmenge einer wachsenden Gütermenge gegenübersteht, führt dies zwangsläufig zu Deflation mit all ihren negativen Folgen, die sich vor allem negativ auf die Kreditvergabe auswirken würden, weil das Risiko, dass die Kredite sich nicht amortisieren größer würde. Gäbe es Deflation und keine Zinsen, wäre es nämlich tatsächlich vorteilhafter, sein Geld zu „horten“.
Antisemitismusvorwurf
Es ist nicht der Fall, dass ich meinem Artikel Zinskritiker pauschal in eine antisemitische Ecke stelle. Im Artikel schreibe ich – in einem einzigen kleinen Nebensatz -, dass Zinskritik oft mit einem antisemitischen Grundton durchmischt sei. Ich wundere mich, dass sich einige Leser an dieser Aussage reiben, ist es doch kein großes Geheimnis, dass antisemitische Machwerke wie Gottfried Feders „Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft“ sich auch heute noch in vielen Foren großer Beliebtheit erfreuen.
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: TippaPatt/shutterstock.com
















