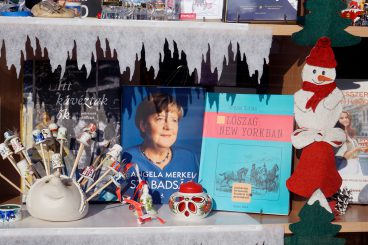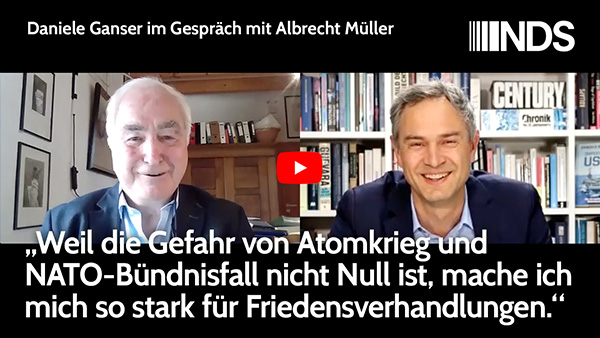Es ist denkbar, dass Angela Merkels Rückzug aus der Politik darauf zurückzuführen ist, dass sie den Niedergang Europas und die nahende Kriegsgefahr erkannte und nicht mehr Teil dieser Entwicklung sein wollte. Nach ihrem Abschied bemüht sie sich subtil, aber gezielt, die Vergangenheit zu beschönigen und ihre eigene Rolle im Geschehen in einem günstigeren, aktuellen politischen Licht darzustellen. Ein Beitrag von Gábor Stier, aus dem Ungarischen übersetzt von Éva Péli.
Am Anfang des Krieges in der Ukraine betonte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel – dem damaligen Trend folgend –, der Minsker Prozess habe Kiew lediglich Zeit verschafft, damit die Ukraine sich militärisch gegen Russland stärken konnte. Als der Krieg jedoch zunehmend Ermüdung hervorrief, erklärte sie, sie sei aufgrund der Corona-Situation und des Widerstands der baltischen Staaten sowie Polens nicht in der Lage gewesen, mit Wladimir Putin zu verhandeln und den Krieg somit abzuwenden.
Die Äußerungen der Altkanzlerin Angela Merkel, die Deutschland 16 Jahre lang regierte und sich im Herbst 2021 aus der Politik zurückzog, sorgten anlässlich der Budapester Vorstellung ihrer Memoiren mit dem Titel „Freiheit“ für erhebliche Wellen – von Moskau über das Baltikum und Polen bis nach Berlin.
Die russischen Medien sahen in diesen Worten eine Bestätigung der – in ihrer Lesart – die europäische Sicherheit schwächenden Russophobie der Polen und Balten. In Warschau, Vilnius, Riga und Tallinn wiederum verbat man sich, von der in ihren Augen zu sehr mit Putin kokettierenden Merkel für den Krieg verantwortlich gemacht zu werden.
Doch auch in Deutschland sorgten diese Aussagen für Aufsehen. In Budapest selbst überdeckte Merkels Erklärung zum Kriegsausbruch sogar die Tatsache, dass sie in einem Interview mit dem ungarischen oppositionellen Sender Partizán Viktor Orbán nicht als Putins Marionette bezeichnen wollte. Die Behauptung, der ungarische Regierungschef sei Putins „Trojanisches Pferd“ in der Europäischen Union, nannte sie Unsinn.
Die Pandemie als Ablenkungsmanöver?
Im Interview hatte der Reporter Merkel an die Aussage von Viktor Orbán erinnert, wonach Putin die Ukraine im Jahr 2022 nicht angegriffen hätte, wenn Angela Merkel Kanzlerin geblieben wäre.
Diese Steilvorlage ließ die Ex-Kanzlerin nicht unbeantwortet. Zunächst merkte sie bescheiden an, dass sie auf diese Frage bereits in ihrem Buch eingehe. Dann kehrte Merkel zur Covid-19-Pandemie zurück und erklärte, diese habe auch die Politik stark beeinflusst. „Hätte Putin die Ukraine auch ohne das Coronavirus angegriffen?“, fragte sie rhetorisch, um dann erneut auf ihr Buch zu verweisen und zunächst vorsichtig festzustellen, dass dies niemand mit Sicherheit sagen könne.
Schließlich vertrat sie die Ansicht, das Ausbleiben persönlicher Treffen habe maßgeblich zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine beigetragen. Sie merkte an, Putin habe auch am G20-Gipfel nicht teilgenommen, da er Angst vor dem Virus gehabt habe; man habe stattdessen Videokonferenzen abhalten müssen. Ob sie Putin in einem persönlichen Gespräch hätte davon abhalten können, einen Krieg zu beginnen, hielt Merkel für eine spekulative Frage.
Die ehemalige deutsche Kanzlerin sprach im Interview mit Partizán auch über das Minsker Abkommen, das 2015 unter ihrer Mitwirkung zustande kam.
Minsker Abkommen: Zwischen Zeitgewinn und Alleinschuldzuweisung
Sie erklärte, das Abkommen habe zwischen 2015 und 2021 „Ruhe geschaffen“ und der Ukraine die Gelegenheit gegeben, „Kraft zu sammeln“ und „ein anderes Land zu werden“. Im Juni 2021 jedoch habe sie gespürt, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Vereinbarung nicht mehr ernst nahm. Daher habe sie ein neues Format vorgeschlagen, in dem die Europäische Union direkt mit Putin verhandeln sollte, um eine gemeinsame Basis zu finden.
Diese Idee sei jedoch von einigen Akteuren – hauptsächlich Polen und den baltischen Staaten – nicht unterstützt worden. Merkel zufolge trug das Verhalten dieser Länder dazu bei, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union abbrachen, und damit indirekt zum Ausbruch des Krieges.
Sie sei der Ansicht gewesen, diese vier Länder „fürchteten, dass es so keine gemeinsame europäische Politik gegenüber Russland geben würde“. Merkels Vorschlag scheiterte, und kurz nach Ablauf ihrer Amtszeit begann Putin die Invasion der Ukraine.
Mit Blick auf die aktuelle Situation passte sich die Ex-Kanzlerin dem westlichen Mainstream an und bezeichnete die Hauptfrage als jene, wie Europa sich bestmöglich für den Frieden rüsten könne. Der Schlüssel dazu sei die Schaffung einer echten Abschreckungskraft und die Unterstützung der Ukraine.
Die baltischen Staaten und Warschau reagierten umgehend mit empörter Kritik an Merkel. Sie bezeichneten ihre Haltung nicht nur als taktlos, sondern auch als fehlerhaft, da die Ex-Kanzlerin damit die russische Propaganda stärke.
Der ehemalige polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf der früheren deutschen Kanzlerin vor, sie sei die Ursache für die Verschärfung der Flüchtlingskrise und trage die Verantwortung für die russische Energieabhängigkeit, von der Europa nun versuche, sich zu befreien. Der frühere lettische Ministerpräsident Krišjānis Kariņš erinnerte daran, er habe Merkel bereits früher mehrfach davor gewarnt, Putin mit gutem Glauben zu begegnen. Er zeigte sich daher schockiert, dass die Altkanzlerin ihre Haltung noch immer nicht geändert habe. „Ich bin froh, dass der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz Merkels Ansichten nicht teilt“, fügte Kariņš hinzu.
Der ehemalige litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis attackierte Merkel in ähnlicher Weise: Sie solle ihr politisches Erbe kritisch überprüfen, anstatt die Verantwortung für die Konsequenzen ihres Handelns auf andere Staaten abzuwälzen. Der frühere Botschafter Jerzy Marek Nowakowski erklärte: „Merkels Äußerungen stärken die russische Propaganda und machen zugleich Osteuropa für den Konflikt zwischen dem Westen und Russland verantwortlich.“ Nowakowski hielt das Interview sogar für „gefährlicher als russische Drohnen“, da es in den westlichen Gesellschaften Zweifel an der Unterstützung der Ukraine wecken könne.
Die Realität des Scheiterns: Kiews Blockade und westliche Tricks
Abgesehen davon, dass Merkel in Abkehr von der politisch korrekten Darstellung die Balten und Polen namentlich als Blockierer benannte, sagte die Ex-Kanzlerin im Grunde nichts Neues. Auch die Blockade des EU-Russland-Gipfels durch diese vier Länder ist keine Neuigkeit, wird aber normalerweise nicht so explizit benannt.
Ebenso ist nicht neu, dass das deutsch-französische Tandem den Minsker Prozess zur Zeitgewinnung nutzte. Dies räumten Angela Merkel und der ehemalige französische Präsident François Hollande bereits Ende 2022 ein. Der ehemalige ukrainische Staatschef Petro Poroschenko untermauerte dies lediglich, indem er erklärte, die Ukraine habe nie die Absicht gehabt, die Minsker Abkommen umzusetzen.
Die Ex-Kanzlerin ist nur noch bemüht, ihre eigene Rolle und den EU-Einfluss im Nachhinein positiver darzustellen. Sie deutet die gescheiterten Verhandlungen als eine von Dritten hintertriebene Gelegenheit zur Kriegsvermeidung. Die Realität ist jedoch, dass Moskau diese Tricks bis 2021 durchschaut hatte und die Entscheidung, die Sache anders – nicht zwingend militärisch – zu lösen, zunehmend reifte.
Merkels aktuelle Erklärung fügt sich somit in ihre Strategie von 2021 ein, deren Kern besagt, dass man Russland nicht nur mit harter Rhetorik, sondern auch mit sinnlosen Verhandlungen „erledigen“ kann.
Im Grunde wurde acht Jahre lang kein substanzieller Dialog mit Moskau geführt, sondern dieser durch leere Slogans, Verweise auf die „Werte“ – selbstverständlich die eigenen! – und ein Versinken in diplomatischer Verzögerungstaktik ersetzt. Als der Kreml dies schließlich satt hatte, zeigte sich der Westen empört und beleidigt über das „Fauchen des Bären“.
Zwar bestand eine geringe Chance, den Krieg zumindest hinauszuzögern, wenn Ende 2021 tatsächlich ernsthafte Verhandlungen begonnen hätten. Moskau erkannte jedoch klar, worauf dieses Spiel hinauslief, und sah seine eigenen Chancen dadurch geschmälert. Merkels aktuelle Position fügt sich auch insofern in den westlichen Mainstream ein, als die Ex-Kanzlerin durchgehend verschleiert.
So verschweigt sie beispielsweise, dass Kiew keinen einzigen der auf Friedensschaffung abzielenden politischen Punkte des Minsker Abkommens umsetzte.
Wäre Kiew beispielsweise zu direkten Verhandlungen mit den Separatisten bereit gewesen und hätte es eine Einigung über die Wahlen im Donbass gegeben, hätte die Ukraine die Kontrolle über den Donbass und die russische Grenze zurückerhalten, und der Konflikt wäre bereits im November 2015 beendet gewesen. Kiew lehnte direkte Gespräche mit den Aufständischen jedoch konsequent ab, weshalb die im Minsker Abkommen vorgesehenen Wahlen nie stattfanden. Infolgedessen hielt der Donbass eigene Wahlen ab, die Kiew nie anerkannte.
Dennoch wiederholt Merkel ihre Behauptung, Russland habe das Abkommen nie eingehalten. Die Ex-Kanzlerin übergeht dabei, dass Moskau ebenso wie Berlin und Paris lediglich Garantiemacht des Abkommens war und nicht Konfliktpartei.
Hinzu kommt, dass all jene, die im Namen Kiews und des Westens über das Minsker Abkommen verhandelten – der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, Kanzlerin Merkel und Frankreichs damaliger Präsident François Hollande – seither offen erklärt haben, sie hätten nie die Absicht gehabt, das Abkommen umzusetzen. Dessen einziges Ziel sei es gewesen, der Ukraine Zeit für die Wiederaufrüstung für den Krieg gegen Russland zu verschaffen.
Angesichts dieser Tatsachen spricht Merkel von ihrem Gefühl, Putin habe das Minsker Abkommen im Sommer 2021 bereits nicht mehr ernst genommen.
Die Suche nach einem eleganten Ausweg aus der Verantwortung
Sie erwähnt auch nicht, dass Berlin und Paris bis November 2021 durch die Ablehnung des zentralen Elements des Abkommens – des direkten Dialogs zwischen Kiew und dem Donbass – das „Normandie-Format“ im Grunde beerdigt hatten.
Merkel schweigt auch darüber, dass der Westen parallel dazu bereits Sanktionen gegen Russland vorbereitete, die unmittelbar nach der Invasion verhängt wurden. Der Westen wollte den Ukraine-Konflikt also durch die De-facto-Aufkündigung des Minsker Abkommens, die Intensivierung der ukrainischen Angriffe auf den Donbass und das forcierte Drängen auf einen NATO-Beitritt der Ukraine eskalieren – oder tat zumindest nicht alles, um den Krieg zu vermeiden.
Warum aber beschuldigt Merkel nun plötzlich die Polen und die baltischen Staaten für die Eskalation in der Ukraine? Vielleicht sieht sie, dass sie einen Weg in einen schrecklichen Krieg geebnet hat und nicht so in die Geschichte eingehen möchte; deshalb versucht sie, die Verantwortung subtil zu verwässern. Daher redet sie von der Pandemie und den Balten.
Wer jedoch die Ereignisse in dieser Region Europas in den letzten gut zehn Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird durch diese Rechtfertigung, die Wunschdenken mit der Realität vermischt, nur in der Überzeugung bestärkt, dass Merkel zusammen mit vielen anderen für die Geschehnisse verantwortlich ist. Schade um diese fehlgeschlagene Anstrengung, denn Angela Merkel steht als Politikerin immer noch über der derzeitigen westeuropäischen Elite.
Der Beitrag ist zuerst im ungarischen Original auf dem ungarischen Fachportal #moszkvater.com erschienen.
Titelbild: Éva Péli