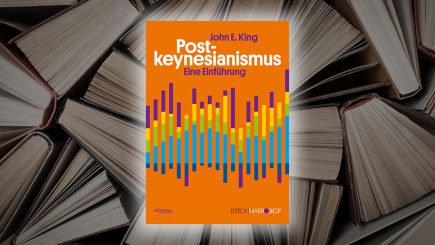Kann die Zentralbank die Inflation bekämpfen? Warum irrt die „schwäbische Hausfrau“? Wie konnte es zur Finanzkrise kommen? Was versteht man unter dem „Paradoxon des Glücks“? Und was unter einem „Militär-Keynesianismus“? Gibt es eine Alternative zur Mainstream-Ökonomie, und wenn ja, welche? Welche sind die philosophischen Grundlagen des Wirtschaftens? Und warum unterliegen gerade deutsche Ökonomen gerne dem „Trugschluss der Verallgemeinerung“? Eine Rezension von Thomas Trares.
Falls Sie mehr als die Hälfte dieser Fragen interessant finden, dann sei Ihnen das Buch „Postkeynesianismus – Eine Einführung“ des australisch-britischen Ökonomen John E. King empfohlen. Erschienen ist es bereits im Jahr 2015, nun wurde es ins Deutsche übersetzt und vom Promedia Verlag des Wiener Verlegers Hannes Hofbauer neu herausgegeben. Die zeitliche Lücke ist kein Nachteil, weil es sich hier um ein Grundlagenbuch handelt, das an keinen unmittelbaren historischen Kontext gebunden ist. Eine gewisse Aktualität erhält es zudem durch den Erfolg der Modern Monetary Theory, die derzeit in aller Munde ist und bei der es sich um eine moderne Variante des Postkeynesianismus handelt.
In seinem Buch erläutert King präzise und allgemein verständlich, was den Postkeynesianismus in seinem Kern ausmacht und was nicht. Postkeynesianismus ist demnach eine Denkschule, die an die Thesen des britischen Starökonomen John Maynard Keynes anknüpft, die dieser in seinem 1936 erschienenen Werk „Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ niedergeschrieben hat. Keynes hatte darin die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre analysiert und die damals vorherrschende klassisch-neoklassische Theorie vom Kopf auf die Füße gestellt. Frühe Vertreter des Postkeynesianismus sind der polnische Ökonom Michal Kalecki, der US-Wissenschaftler Paul Davidson und die Britin Joan Robinson.
Kernaussagen des Postkeynesianismus
Die Kernaussagen des Postkeynesianismus lassen sich wie folgt zusammenfassen: In einer Volkswirtschaft werden Produktion und Beschäftigung von der Nachfrageseite her bestimmt, nicht von der Angebotsseite. Arbeitslosigkeit ist unfreiwillig und Geld nicht neutral. Motor des Systems sind die „kapitalistischen Profiterwartungen“, maßgebliche Akteure die börsennotierten Großkonzerne, die zumeist auf oligopolistisch organisierten Märkten agieren. Angetrieben wird die Wirtschaft vor allem von den Unternehmensinvestitionen, wobei die Investitionsentscheidungen unter dem Diktum fundamentaler Unsicherheit erfolgen. All dies führt dazu, dass wirtschaftliche Prozesse krisenanfällig und instabil sind, was wiederum eine aktive Rolle des Staates begründet. Klar abzugrenzen davon sind gleichgewichtsorientierte Denkschulen wie der Monetarismus und die Neoklassik, aber auch Konzepte wie die Neue Neoklassische Synthese.
Bücher wie das von King helfen vor allem dabei, die Gedanken zu ordnen und die Wirklichkeit begreifbar zu machen. So werden viele aktuelle Phänomene erst verständlich, wenn man den theoretischen Hintergrund kennt. Zum Thema Inflation schreibt King beispielsweise: „Die Ursachen von Inflation sind in der realen Wirtschaft zu suchen, auf dem Produktmarkt und insbesondere auf den Märkten für Arbeit und Rohstoffe. Der Versuch, Inflation durch die starre Kontrolle des Geldmengenwachstums zu bekämpfen, ist zum Scheitern verurteilt und wird stattdessen durch die damit verbundenen fiskalischen Sparmaßnahmen, hohen Zinssätze und überbewerteten Wechselkurse der Produktion und der Beschäftigung schweren Schaden zufügen.“ (S. 141) So oder so ähnlich argumentieren in der aktuellen Inflationsphase auch Keynesianer wie der frühere UNCTAD-Chefvolkswirt und Finanzstaatssekretär Heiner Flassbeck.
Fiskalpolitik entscheidende Stellschraube
Ohnehin gehen Postkeynesianer davon aus, dass die Wirksamkeit der Geldpolitik begrenzt ist. Sie sehen vielmehr in der Fiskalpolitik die entscheidende Stellschraube zur Steuerung der Wirtschaft. Ihr obliegt es, Vollbeschäftigung herzustellen und nachfragebedingte Inflation zu vermeiden. Konzepte wie das der „schwäbischen Hausfrau“ und die damit einhergehende Schuldenbremse lehnen Postkeynesianer dagegen ab. „Die schwäbische Hausfrauenlogik ist also ein Irrglaube. Die Staatsverschuldung ist keine Last für die nachkommenden Generationen. Sie ist weder eine Last für eine Nation noch ein Zeichen für nationale Armut. Auch die Zinsen für die Staatsschulden sind keine Belastung für einen Staat. Ein Staat kann nicht in den Bankrott getrieben werden. Das liegt daran, dass weder der Staat noch die Regierung Unternehmen sind (und schon gar nicht eine schwäbische Hausfrau)“, schreibt King. (S. 148)
Ein „Schmankerl“ ist auch das Kapitel über die philosophischen Grundlagen des Postkeynesianismus. Dort tauchen dann – in der ökonomischen Literatur eher eine Seltenheit – Begriffe wie „Nicht-Ergodizität“, „babylonisches Denken“ und „Ontologie des Wirtschaftsuniversums“ auf. Dabei geht es unter anderem um die Kontroverse zwischen Postkeynesianern und Neoklassikern, ob in der Ökonomie – ähnlich wie in den Naturwissenschaften – zukünftige Ereignisse präzise vorausgesagt werden können. „Wir können nicht sicher sein, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit. Wirtschaftliche Ereignisse sind nicht so präzise vorhersehbar wie die genauen Zeiten von Ebbe und Flut“, schreibt King dazu. (S. 73)
Wissenschaftstheorie ist wichtig
Die Schlussfolgerungen aus diesem Kapitel sind aber keineswegs weltfremd und abgehoben, sondern sogar sehr real und fundamental. King nennt hier als Beispiel die Deregulierung des Finanzsektors in den USA, die auf „grob unrealistischen Annahmen“ über die Natur des Wirtschaftsraums beruht habe und es den Banken erlaubte, „gefährlich waghalsig zu operieren und eine unbekümmerte Haltung gegenüber der Verschuldung einzunehmen“. Diese Ignoranz habe dann erst zu der inadäquaten Regulierung der Finanzmärkte geführt und die Finanzkrise von 2007/08 mitheraufbeschworen. „Wissenschaftstheorie ist also wichtig!“, schreibt King. (S. 71)
Passend dazu enthält das Buch auch eine Analyse der Finanzkrise aus postkeynesianischer Sicht. „Ursache der GFC [allgemeinen Finanzkrise, Anm. d. Verf.] war eine toxische Mischung aus Globalisierung, Finanzialisierung, Deregulierung, zunehmender Ungleichheit und steigender Verschuldung, propagiert (wenn nicht sogar initiiert) von Mainstream-Ökonomen auf Basis neoliberaler Ideologien“, schreibt King (S. 174). Zentral aus postkeynesianischer Sicht sind hier außerdem die Schriften des US-Ökonomen Hyman Minsky über die Instabilität des Finanzsystems sowie die politischen Forderungen nach einer systematischen Regulierung der Finanzmärkte und einer radikalen De-Finanzialisierung. Letzteres bedeutet, dass der Finanzsektor „substanziell an Größe, Instabilität und politischer Macht“ verlieren muss.
Irrweg der Mikrofundierung
Interessant ist auch die Kontroverse zwischen Postkeynesianern und Mainstream-Ökonomen, die King unter der Überschrift „Irrweg der Mikrofundierung“ diskutiert. Dabei geht es um die Frage, ob die Makroökonomie ein mikroökonomisches Fundament haben sollte, sprich ob sich aus dem Verhalten von Individuen Rückschlüsse auf das Verhalten des Gesamtsystems ziehen lassen. Postkeynesianer lehnen diese Sichtweise strikt ab. Sie werfen den Neoklassikern vielmehr vor, hier dem „Trugschluss der Verallgemeinerung“ zu unterliegen, ein Vorwurf, der gerade auf viele deutsche Ökonomen mit ihrem ausgeprägten Spar- und Exportwahn zutrifft. So mag das Sparen aus Sicht eines Individuums rational sein wie auch das Anhäufen von Exportüberschüssen für eine Volkswirtschaft. Verhalten sich jedoch alle Individuen bzw. Staaten so, dann führt dies wirtschaftlich in die Katastrophe.
Eine Ironie der Geschichte ist jedoch, dass Postkeynesianer und Neoklassiker zwar in ganz vielen Fragen über Kreuz liegen, in einem ganz bestimmten, klar definierten Bereich aber postkeynesianische Konzepte doch auf wenig Widerstand stoßen. Die Rede ist von den Rüstungsausgaben. Dazu schreibt King: „Rüstungsausgaben sind den Kapitalisten jedoch weniger unangenehm als zivile Ausgaben, sodass sich der ‚Militär-Keynesianismus‘ dort als politisch akzeptabel erweisen kann, wo hohe Löhne und der Sozialstaat es nicht sind.“ (S. 32) Beispiele hierfür sind alle Arten von Kriegsproduktion, aber auch die SDI-Programme unter dem früheren US-Präsidenten Ronald Reagan. Und auch hierzulande deutet sich nun mit der „Zeitenwende“, den Forderungen von Politikern nach mehr „Kriegstüchtigkeit“ und der damit einhergehenden Aufstockung der Rüstungsausgaben eine neue Art von „Militär-Keynesianismus“ an.