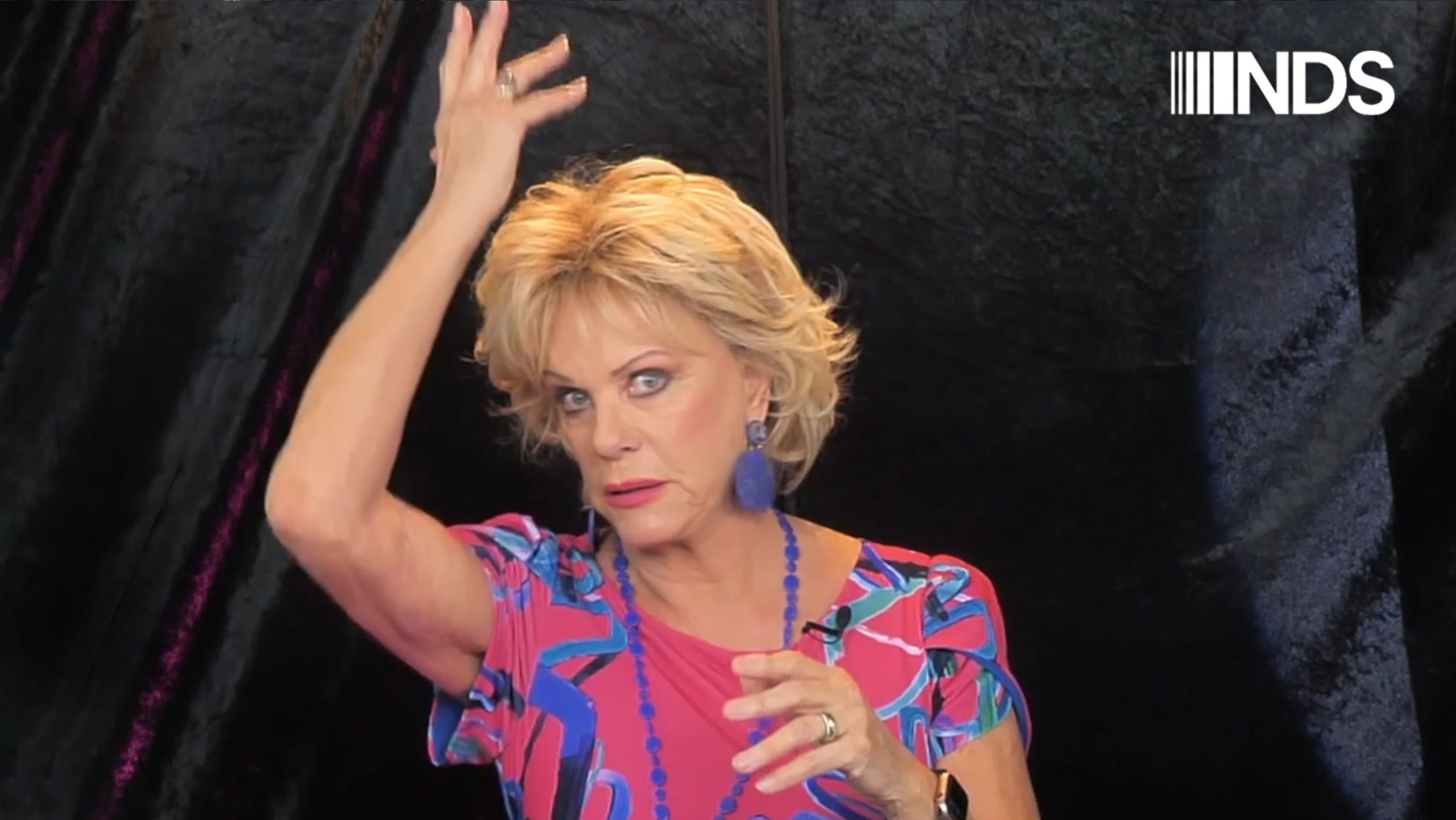Als am Mittwoch die neue Artilleriemunitions-Produktionsline des Rheinmetall-Werks im niedersächsischen Unterlüß in Betrieb genommen wurde, war viel Prominenz angereist. Neben dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellten sich auch zwei niedersächsische SPD-Granden dem Blitzlichtgewitter: Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Niedersachsen steht wie wohl kaum ein anderes Bundesland für die von Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“: Das einstige „Autoland“ soll nun, da es mit den Autos nicht mehr so gut läuft, zum „Rüstungsland“ werden – wenn es das nicht ohnehin schon ist. Diese Strategie ist brandgefährlich, kann sie doch nur aufgehen, wenn Deutschland dauerhaft gigantische Mengen an Rüstungsgütern abnimmt und dabei noch gigantischere Mengen von Steuergeldern in die Rüstungsindustrie fließen. Es ist zu befürchten, dass dies das neue Standortkonzept der SPD ist. Armes Niedersachsen, armes Deutschland. Von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Dieser Artikel liegt auch als gestaltetes PDF vor. Wenn Sie ihn ausdrucken oder weitergeben wollen, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Weitere Artikel in dieser Form finden Sie hier.
Für Deutschlands Militaristen war der vergangene Mittwoch zweifelsohne ein guter Tag. Nach Jahren, ja Jahrzehnten der schlechten, teils gehässigen Kommentare über deutsche Rüstungsgüter gab es endlich Superlative zu feiern. Gerade einmal anderthalb Jahre nach dem Spatenstich nahm nun die erste Produktionslinie für Artilleriegranaten im niedersächsischen Unterlüß ihren Betrieb auf. Noch in diesem Jahr will Rheinmetall dort 25.000 Schuss produzieren, bis 2027 sollen es jährlich 350.000 werden. Zusammen mit anderen Werken will Rheinmetall in den nächsten zwei Jahren den Ausstoß an Artilleriegranaten auf sagenhafte 1,5 Millionen Geschosse pro Jahr hochfahren. Die „Tagesschau“ meldet dazu vollkommen unkritisch, dass Rheinmetall damit „seine Position als stärkster Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in der westlichen Welt festigen“ würde.
Und das soll zumindest nach den Vorstellungen von Rheinmetall auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Nun will man in andere Länder expandieren und dort ebenfalls Munitionswerke nach dem Konzept von Unterlüß errichten. Genannt werden dabei Litauen und Großbritannien, wo es bereits konkrete Projekte gebe – aber auch Staaten wie Rumänien, Lettland und die Ukraine, die laut Rheinmetall-Chef Papperger „noch entschlossener in die Lage versetzt werden muss, die dringend benötigten Schutz- und Verteidigungsgüter im eigenen Land zu produzieren“. Wofür allein Deutschland 1,5 Millionen Artilleriegeschosse pro Jahr braucht und was mit den Werken passiert, wenn es – Gott bewahre – in der Ukraine zu einem Waffenstillstand oder gar Frieden kommt, fragt das Schlachtschiff des öffentlich-rechtlichen Journalismus lieber nicht.
Das hat System. Deutschland befindet sich im Strukturwandel. Doch leider sprechen wir nicht über den Wandel einer exportgetriebenen Volkswirtschaft, deren Produktportfolio in die Tage gekommen ist, zu einer zukunftsfesten innovativen und nachhaltigen Volkswirtschaft. Statt auf regenerative Energien, KI-Technologie, die Mobilitätswende oder auch nur die bessere Verzahnung von Universitäten, Forschung und Start-ups zu setzen, soll Deutschlands wirtschaftliches Rückgrat ausgerechnet die Rüstungsindustrie werden. Einen ähnlichen Strukturwandel gab es schon in der spätwilhelminischen Zeit und im Dritten Reich, und wir wissen, wohin das geführt hat. In Niedersachsen lässt sich diese Entwicklung wie unter einem Brennglas betrachten.
Niedersachsens rüstungsindustrielles Ökosystem
In Niedersachsen gibt es die „Großen“, wie Airbus mit zwei Standorten oder halt Rheinmetall mit dem größten Rüstungsstandort Deutschlands in der sonst beschaulichen Lüneburger Heide. Dann gibt es noch die „Hidden Champions“, Firmen wie die Werft Abeking & Rasmussen in Lemwerder, die neben Luxusyachten auch als Weltmarktführer Minensuchboote herstellt. Schon heute gibt es in Niedersachsen aber auch ein komplettes Ökosystem mit militärischen Zulieferern wie beispielsweise das Unternehmen Vincorion aus Wedel, das Energiesysteme für Panzer herstellt. Ähnlich wie bei der Autoindustrie ist die Produktion von militärischen Großgeräten heute ein Projekt, das zu großen Teilen auf unzählige Zulieferbetriebe ausgegliedert wurde. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass am Bau eines Panzers mindestens 150 mittelständige Unternehmen beteiligt sind.
So stammen die Getriebe der meisten von Rheinmetall hergestellten Panzer vom Augsburger Unternehmen Renk AG, die sie jedoch in ihrem Werk in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover fertigen lässt. Früher gehörte Renk übrigens zu MAN und war bis 2020 im Besitz der Volkswagen AG. Aber das war ja vor der Zeitenwende, als man meinte, mit Autos mehr Geld als mit Panzern verdienen zu können. Volkswagen nahm damals 530 Millionen Euro mit dem Verkauf von Renk ein, heute weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als sechs Milliarden Euro auf – die Zeitenwende hat sich für Renk und seine neuen Besitzer gelohnt; dazu zählt übrigens vor allem das schwedische Private-Equity-Unternehmen Triton, an dem unter anderem die Familie des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad beteiligt ist. So fließt mit jedem niedersächsischen Panzer Geld in die Kassen schwedischer Multimilliardäre, die ihr Geld steueroptimiert in einer niederländischen Stiftung verwalten lassen. Für Niedersachsen springen immerhin einige wenige Jobs heraus. Wie viel Prozent der Steuergelder, die für derartige Rüstungsgüter ausgegeben werden, nun an die Arbeitnehmer vor Ort und wie viel an milliardenschwere Investoren im Ausland gehen, ist nicht seriös zu schätzen, Zahlen dazu sind Verschlusssache. Man kann aber durchaus vermuten, dass es sich bei den Löhnen eher um die Krumen vom Tisch der Reichen handelt und der große Verlierer am Ende einmal mehr der Steuerzahler ist.
Rheinmetall – Rüstungschampion seit Kaisers Zeiten
Ein großer Gewinner der Zeitenwende ist zweifelsohne das Unternehmen Rheinmetall, der größte Rüstungskonzern Deutschlands. Heute weist der Konzern eine Marktkapitalisierung in Höhe von 75 Milliarden Euro auf – mehr als 50 Prozent so viel wie der Volkswagen-Konzerns, der zweitgrößte Automobilbauer der Welt. Vor Olaf Scholz’ Zeitenwende-Rede war Rheinmetall übrigens nur vier Milliarden Euro wert. Auf Kosten des Steuerzahlers hat sich der Wert des Unternehmens somit fast verzwanzigfacht. Aber wen wundert das? Es gibt wohl keinen Konzern, der ein so umfangreiches Polit-Lobbying betreibt wie Rheinmetall. Konzernchef Papperger ist ein Duz-Freund von Boris Pistorius und auch mit dem Ex-Kanzler Olaf Scholz ist er auf freundschaftlicher Ebene verbunden. Wenn es um Rheinmetall geht, lässt auch die Bundespolitik gerne mal „Viere gerade sein“ und nimmt es mit den eigenen Vergaberichtlinien nicht so genau.
In Unterlüß in der Lüneburger Heide wird von Rheinmetall unter anderem die Großkalibermunition für nahezu alle Panzer und Artilleriesysteme produziert, die in Deutschland im Einsatz sind. Hier arbeiten 2.800 Menschen, 600 wurden erst nach der Zeitenwende eingestellt, und aktuell suchen die Rüstungsbauer mindestens 200 weitere Mitarbeiter, Tendenz stark steigend. Einige Waffensysteme fertigt Rheinmetall in Eigenregie, andere in Kooperation – so werden in Unterlüß beispielsweise in einem Joint-Venture mit der VW-Tochter MAN die LKW der Bundeswehr produziert. MAN liefert die zivilen, Rheinmetall die militärischen Komponenten.
Wenn Medien wie der NDR über Rheinmetall berichten, so sucht man Kritik meist vergebens. Selbst die „125-jährige Firmengeschichte“ wird in Beiträgen des NDR wie von magischer Hand durch Weglassen der „düsteren Perioden“ geschönt. Bereits im Ersten Weltkrieg lieferte die „Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft“ von Unterlüß aus – auch mit französischen Zwangsarbeitern – die Munition, mit der die kaiserlichen Truppen ihr tödliches Handwerk verrichten konnten. In der Nazizeit wurde das Werk dann verstaatlicht und vom fusionierten Staatsbetrieb Rheinmetall-Borsig betrieben, der später in die Reichswerke Hermann Göring eingegliedert wurde.
Ab 1939 wurden dort polnische, ab 1942 russische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt, die in mehreren dafür gebauten Lagern in der Nähe des Werkes untergebracht wurden. 1944 folgte schließlich noch ein Außenlager des KZs Bergen-Belsen, in dem vornehmlich ungarische Jüdinnen, die aus Auschwitz überstellt wurden, unter kaum vorstellbaren Bedingungen arbeiteten. 1945 wurden das Werk Unterlüß und seine zu diesem Zeitpunkt 5.000 Zwangsarbeiter schließlich von den Briten befreit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rheinmetall-Borsig wieder reprivatisiert und produzierte in Unterlüß zunächst Textilmaschinen. Als die Briten dann jedoch abzogen und die junge Bundesrepublik ihre Bundeswehr gründete, brauchte man auch wieder Waffen und Munition aus Unterlüß. 1955 war das unfreiwillige zehnjährige Intermezzo vorbei, und der Standort Unterlüß wurde wieder zur Waffen- und Munitionsschmiede der Republik.
All dies scheint der NDR zu vergessen, wenn er stolz vom „125-jährigen Standortjubiläum“ schreibt – aber ja, der NDR gehört ja auch zum niedersächsischen Komplex, und auch das zum NDR-Reich gehörende Schleswig-Holstein gehört vor allem mit dem Marine- und Werftenstützpunkt Kiel zu den großen „Gewinnern“ der Rüstungsprogramme. Da erwähnt man lieber, wie viel Geld Rheinmetall doch der Gemeinde an Gewerbesteuern einbringt und dass der Steuergeldregen durch die Munitionsfabrik nun der Gemeinde ermögliche, das Schwimmbad und das Bürgerhaus zu sanieren und anzubauen. „Rheinmetall braucht Unterlüß und Unterlüß braucht Rheinmetall“, so der NDR ganz nonchalant. Und auch hier mache sich die Zeitenwende bemerkbar, schließlich habe Rheinmetall zahlreichen ehemaligen Mitarbeitern des Automobilzulieferers Continental eine neue, zukunftssichere Arbeit gegeben.
Die Zeitenwende hat Rheinmetall zum „weißen Ritter“ einer sterbenden Region gemacht. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Rüstungskonzern nun im nahen Braunschweig auch die Betriebsstätte des schwer angeschlagenen Luftfahrt-Start-ups Leichtwerk übernommen hat. Wo früher zivile Leichtflugzeuge entworfen und hergestellt wurden, werden künftig militärische Drohnen gebaut. Protest? Bedenken? Immerhin „rettet“ Rheinmetall damit 40 hochqualifizierte Arbeitsplätze, das gefällt der lokalen Politik.
Panzer statt Autos – Das VW-Werk in Osnabrück
Der Strukturwandel, der sich derzeit in Niedersachsen vollzieht, ist vor allem in der Automobilbranche zu bemerken. Über Jahrzehnte hinweg war Niedersachsen – im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen – das Autoland schlechthin. Rund um die Werke des VW-Konzerns hat sich ein sehr umfangreiches System von Zulieferern aus dem „Automotive-Bereich“ in Niedersachsen niedergelassen. Doch mit Autos made in Germany läuft es bekanntlich seit einigen Jahren nicht mehr so gut. Es heißt, man habe am Markt vorbei entwickelt, die Zeichen der Zeit verschlafen. Wie dem auch sei, in der Branche und in der Landes- und Regionalpolitik herrscht jedenfalls Katerstimmung. So mancher denkt nun bereits offen darüber nach, „Panzer statt Autos“ zu produzieren.
Auch hier nimmt die Rüstungsindustrie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Rolle des „weißen Ritters“ ein und die Politik spielt dieses Spiel oft nur allzu gerne mit. Das jüngste Beispiel dafür ist das VW-Werk in Osnabrück. Dieses Werk kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1901 begann hier der Kutschenbauer Wilhelm Karmann, die ersten Karosserien für Autos zu bauen. Später wurden in Osnabrück zunächst in Eigenregie und später in Auftragsfertigung Cabrios gebaut. 2011 übernahm dann VW das Werk, doch die Auftragslage ist bescheiden und 2027 laufen die letzten Baureihen von Porsche und VW in Osnabrück aus. Vor Ort will man eine Werksschließung verhindern. Doch wie?
Einmal mehr tauchte Rheinmetall als angeblicher Retter in der Not auf. Man könne sich gut vorstellen, in Osnabrück künftig zusammen mit VW Militärfahrzeuge zu produzieren, und damit den Fortbestand des Standortes sichern, verlautbarte Rheinmetall im März. Schnell wurde seitens Politik und VW zumindest öffentlich zurückgerudert. An den Spekulationen sei nichts dran, so hieß es. Glaubhaft waren diese Dementis aber nie.
Schon länger gibt es eine Kooperation zwischen der VW-Nutzfahrzeugsparte MAN und Rheinmetall bei Militärfahrzeugen. Und hinter den Kulissen sind sich Rheinmetall und VW auf der Chefetage wohl auch schon einig. Man müsse aber eine sichere Auftragslage durch den Bund haben und brauche dafür einen Rahmenvertrag über zehn Jahre.
Nach anfänglicher Kritik hat sich nun auch die IG Metall für die militärische Lösung geöffnet. Anfang dieser Woche sagte Thorsten Gröger von der IG Metall, er ließe sich diese Option offen: „Wenn ein Werk morgen etwas anderes produziert als heute, ist das keine Schließung. Entscheidend ist: Von guter in gute Arbeit ist immer besser als in Arbeitslosigkeit.“ Die Rolle der IG Metall ist bei dieser Entscheidung wichtig. Durch das VW-Gesetz haben die Belegschaft und das Land Niedersachsen eine Mehrheit im Aufsichtsrat. Für Rheinmetall ist dies eine Win-Win-Situation – das Land Niedersachsen sorgt im Aufsichtsrat für einen positiven Beschluss und lässt via SPD seinen Einfluss spielen, dass es den nötigen Rahmenvertrag gibt, der das Geschäft für Rheinmetall vergoldet.
Dabei gäbe es für das VW-Werk in Osnabrück durchaus denkbare Alternativen, wie es der Brancheninsider Stephan Krull in einem lesenswerten Artikel zum Thema analysiert. Das Problem: Politik und Medien stellen den Strukturwandel hin zur Rüstungsindustrie heute genauso als alternativlos dar, wie sie es vor wenigen Jahren noch mit der Energiewende oder der Mobilitätswende getan haben. Rüstung liegt voll im Zeitgeist und die Weichen scheinen bereits gestellt zu sein. So wird es niemanden ernsthaft wundern, wenn demnächst in der „Friedensstadt“ Osnabrück Militärfahrzeuge vom Band laufen.
Ein Land im Strukturwandel
Hätte es das Dritte Reich nicht gegeben, sähe Niedersachen heute auch wirtschaftlich anders aus. Das ist keine steile These, sondern ein simpler, in Niedersachsen nicht gerne gehörter Fakt. Die heutigen Wirtschaftszentren, die vor allem den Süden des Bundeslandes dominieren, sind die Auto- und die Stahl- bzw. metallverarbeitende Industrie. Wo 1938 noch plattes Weideland rund um das Dorf Fallersleben war, steht heute die Großstadt Wolfsburg mit ihrem Stammwerk der VW AG, das rund 62.000 Menschen direkt und Hunderttausende Menschen in der Region indirekt beschäftigt und bis vor Kurzem auch flächenmäßig die größte Fabrikanlage der Welt war. Wenige Kilometer südlich findet sich die Stadt Salzgitter mit ihrem riesigen Stahlwerk der Salzgitter AG – gegründet 1937 als Reichswerke Hermann Göring; wie das damalige KdF-Werk in Wolfsburg eine Reißbrettplanung mitten im Nirgendwo. Heute ist Salzgitter – wenn auch nur durch Eingemeindungen – eine Großstadt. In den 1930ern war Salzgitter-Bad noch ein 3.000-Seelen-Dorf im Landkreis Goslar.
Stahl und Autos – die Produkte, die die Region über Jahrzehnte hinweg wohlgenährt haben und unzählige Zuliefererbetriebe angezogen haben, sind heute Auslaufmodelle. Die Salzgitter AG schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen, die Energiekosten und Umweltauflagen haben die Stahlherstellung in Deutschland international abgehängt. Wofür braucht man auch Stahl? Gebaut wird kaum noch, deutsche Autos verkaufen sich schlecht. Etwas Hoffnung brachte die erzwungene Umstellung der Gasversorgung. Erst verdiente man gut am Bau der Nord-Stream-Pipelines, dann verdiente man gut am Bau der neuen Gasleitungen, die nötig sind, um die LNG-Terminals ans Verteilnetz zu nehmen. Aber auch das ist irgendwann geschehen, und ohne das preiswerte Nord-Stream-Gas zerfiel auch das Zukunftsmodell der Salzgitter Stahl, in Deutschland grünen Stahl zu produzieren, in sich selbst.
Nun setzt man auf grünen Stahl aus Wasserstoff-Strom – nur dass der ohne gigantische Subventionen so teuer ist, dass er in der Privatwirtschaft keine Kunden finden würde – außer in der staatlich subventionierten Rüstungswirtschaft, bei der die Controller nicht so genau auf die Zahlen schauen. So sieht die Salzgitter Stahl AG nun auch ihre wirtschaftliche Zukunft als Zulieferer der Rüstungsindustrie. Unternehmensintern hat man nun eine „Task Force Verteidigung“ gegründet. Ein guter Freund von mir, der bei dem Unternehmen tätig war, reichte an diesem Tag die Kündigung ein. Aber nicht jeder hat den Luxus, in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit einen neuen Job zu finden. So kommt es, dass das von den Nazis zur Rüstungsproduktion gegründete Stahlwerk bald wieder für die Rüstungsproduktion arbeitet – welch bittere Pointe.
Ähnlich dürfte es den Mitarbeitern der Meyer Werft in Papenburg gehen. Dort wurden bis vor Kurzem Kreuzfahrtschiffe gebaut, doch die Coronazeit brachte die Branche in Schieflage, Aufträge wurden storniert oder verschoben, das Land Niedersachsen stieg mit 80 Prozent bei der Werft ein. Die Begründung dafür muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – Papenburg liegt außerhalb der Reichweite russischer Kurzstreckenraketen aus dem Oblast Kaliningrad und sei daher von hoher strategischer Bedeutung, „um im Falle zunehmender sicherheitspolitischer Spannungen Marineschiffe bauen zu können“. Genau das soll jetzt auch geschehen. Laut einem Restrukturierungsplan sollen künftig nicht mehr Kreuzfahrtschiffe, sondern Fregatten in Papenburg vom Stapel laufen. Natürlich – mit dem Land Niedersachsen als Mehrheitseigner ist man ein politisches Unternehmen, und staatliche Aufträge wird es dank der Zeitenwende schon ausreichend geben.
Niedersachsen und die SPD – ein ideales Umfeld für die Rüstungsindustrie
Die niedersächsische SPD stand schon immer der Rüstungsindustrie und ihrer Lobby sehr nahe, und seit vielen Jahren haben die Niedersachsen in der SPD die Deutungshoheit gewonnen. Der heutige Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil wuchs als Sohn eines Soldaten in der Bundeswehrstadt Munster auf und gehörte seit 2017 den Präsidien der Lobbyvereine Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik und Förderkreis Deutsches Heer an. Politisch machte er sich schon lange vor der Zeitenwende für eine massive Erhöhung der Rüstungsausgaben stark. Ob aus Überzeugung oder aus Opportunismus, ist nicht bekannt – sein Wahlkreis grenzt jedenfalls an den Rheinmetall-Standort Unterlüß.
Fest an seiner Seite steht dabei Boris Pistorius, seines Zeichens Verteidigungsminister, der zum „Kanzler der Herzen“ hochgeschrieben wurde. Auch Pistorius ist Niedersachse, und für einen SPD-Politiker ist seine Karriere wohl auch nur in Niedersachsen so denkbar. Protegiert wurde er über Jahre hinweg von Sigmar Gabriel, Goslarer, Niedersachse und Freund der Rüstungsindustrie, und Stephan Weil, Hannoveraner, Niedersachse und ebenfalls Freund der Rüstungsindustrie, der kurz vor seinem Abtritt als niedersächsischer Ministerpräsident noch verkündete, er wolle die Rüstungsindustrie in Niedersachsen noch weiter stärken, da diese ein „absoluter Wachstumsbereich“ sei. Dass sein Amtsnachfolger Olaf Lies, der den rüstungsindustriefördernden Kurs Weils in zwei Kabinetten als Wirtschaftsminister exekutiert hat, das anders sieht, ist auszuschließen.
Es war der SPD-Kanzler Olaf Scholz, zwar in Niedersachsen geboren, aber politisch ein Hamburger, der die Zeitenwende ausrief und die ersten 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung bereitgestellt hat. Boris Pistorius war später der größte Lobbyist für die Fünf-Prozent-Regelung bei den Rüstungsausgaben, die dann sein Parteichef Lars Klingbeil als Finanzminister auch umgesetzt hat. Sie haben den Rahmen geschaffen, aber nicht nur das. Immer dann, wenn es um die Ansiedlung und Stärkung der Rüstungsindustrie, insbesondere durch Konzerne wie Rheinmetall, ging, hat in Niedersachsen die SPD dabei eine signifikante Rolle gespielt. Scholz, Pistorius und Weil haben den Bau der neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall in Unterlüß aktiv unterstützt.
Auch bezüglich des Einflusses auf die Bundes-SPD und Lobbying in der Bundespolitik gibt es klare Verbindungen: Die niedersächsische SPD nutzt ihre Position, um bundespolitische Entscheidungen zu beeinflussen, etwa durch die Förderung von Aufrüstungsprogrammen wie dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr. Stephan Weil hat sich öffentlich für mehr Rüstungsinvestitionen eingesetzt und Kritik an Abrüstung geäußert, was mit der Linie der SPD-Bundesführung um Scholz und Pistorius übereinstimmt.
Diese Strategie führt entweder in eine Sackgasse oder in den Krieg
Über die makroökonomische Sinnlosigkeit der Aufrüstung hatte ich bereits im Artikel „Vom „Green New Deal“ zum „olivgrünen Wirtschaftswunder“ – der Irrsinn regiert“ ausführlich geschrieben. Schauen wir uns heute zunächst einmal die betriebswirtschaftliche Perspektive an. Um es klar zu sagen: Kurzfristig mag es für ein Unternehmen durchaus sinnvoll erscheinen, militärische anstatt ziviler Güter zu produzieren. Spätestens seit der Ära „Lopez“ stehen die Zulieferer der Automobilindustrie unter einem riesigen Kostendruck. Einkäufer und Controller der Automobilhersteller sind gnadenlos und will man überhaupt im Geschäft bestehen, muss man schon mit einem sehr spitzen Bleistift kalkulieren. Das ist in der Rüstungsindustrie gänzlich anders. Hier hat der Staat ein Nachfrageoligopol und das Beschaffungssystem der Bundeswehr ist ja bekannt für seine Nachlässigkeit. Das ist gut für die Margen. Problematisch für die Anbieter ist dabei jedoch, dass die Nachfrage – anders als bei zivilen Gütern – politisch reguliert ist.
Zugespitzt könnte man sagen: Wenn der Frieden ausbricht, sind die positiven Geschäftsaussichten der Rüstungsindustrie samt ihrer Zulieferer dahin. Irgendwann sind die Arsenale voll und in Manövern kann auch die Bundeswehr nicht Millionen und Abermillionen Artilleriegeschosse pro Jahr verschießen. Zwar mag es in bestimmten High-Tech-Bereichen auch hier „Innovationszyklen“ geben, sodass z.B. veraltete Drohnen durch neue Modelle ersetzt werden, aber für die große Masse militärischer Produkte gibt es nun mal eine natürliche Obergrenze.
Das lässt zwei Alternativen offen: Man fährt die Beschaffungsausgaben runter, wenn die Arsenale voll sind oder man sorgt dafür, dass die militärischen Güter verbraucht werden; vulgo, man führt einen Krieg. Ersteres wäre aus rein ökonomischer Perspektive schlecht für den Wirtschaftsstandort; dann müssten die nun gebauten Werke wieder geschlossen werden. Letzteres wäre aus allen denkbaren Perspektiven katastrophal. Aber eine andere Alternative gibt es für dieses Szenario nicht. Tertium non datur. Man kann nur hoffen, dass sich diese simple Wahrheit auch irgendwann bei der Politik und in den Medien herumspricht; nicht nur in Niedersachsen.
Titelbild: Screenshot NDR