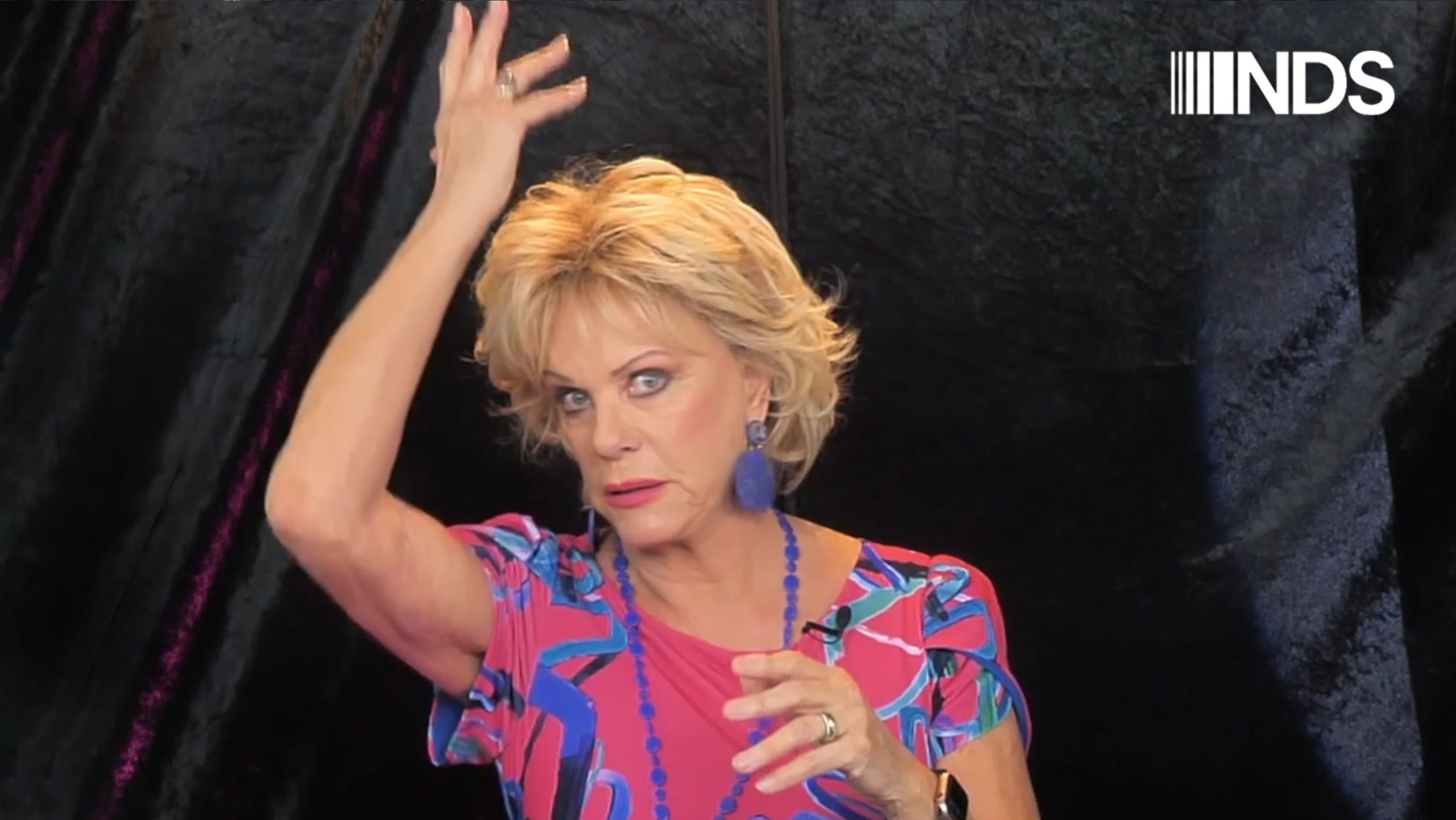Die Ermordung mutmaßlicher Drogenhändler in Venezuela durch Donald Trump ohne Gerichtsverfahren zählt zu den größten Gefahren seiner zweiten Amtszeit. Sie ist Teil der parteiübergreifenden Geschichte der US-amerikanischen Übergriffe im Namen der nationalen Sicherheit. Von Chip Gibbons.
Am 15. September 2025 gab das Weiße Haus unter Trump wieder einmal bekannt, dass es einen Militärschlag gegen ein Boot in der Karibik durchgeführt habe. Nach Angaben der Regierung wurden dabei drei Menschen getötet. Dies war der zweite derartige Schlag innerhalb von zwei Wochen. Am 2. September waren elf Menschen in einem kleinen Schnellboot unterwegs in internationalen Gewässern, als sie ebenfalls durch einen Militärschlag der USA getötet wurden. Die außergerichtlichen Hinrichtungen wurden gefilmt und von der US-Regierung prahlerisch in den sozialen Medien veröffentlicht.
Die Trump-Regierung hat diese Tötungen damit erklärt, dass die Personen Teil eines venezolanischen Kartells und in den Drogenhandel verwickelt gewesen seien. Mit der Behauptung, dass die Drogenkartelle Terroristen seien und dass das Problem der Überdosen in den USA die Drogenhändler zu einer Bedrohung für das Land mache, erklärte die Regierung, dass ihre tödliche Militäraktion gerechtfertigt sei. Für keine der getöteten Personen legte sie jedoch Beweise dafür vor, dass sie in den Drogenhandel verwickelt oder Teil eines Kartells gewesen seien.
Außerdem hat die US-Regierung widersprüchliche Erklärungen darüber abgegeben, was genau passiert ist. Nach dem ersten Angriff auf ein Schnellboot behauptete Außenminister Marco Rubio zunächst, das Boot sei nicht einmal auf dem Weg in die USA gewesen, sondern zu einer anderen Insel in der Karibik. Dann änderte die Regierung ihre Darstellung und gab an, das viermotorige Schnellboot sei auf dem Weg von Venezuela in die Vereinigten Staaten gewesen. Zudem wurde bekannt, dass das Boot umgedreht hatte, nachdem es durch ein vor ihm fliegendes Militärflugzeug der USA verschreckt worden war. Das US-Militär feuerte wiederholt auf das Boot, um die Überlebenden des ersten Angriffs zu töten.
Diese militärischen Angriffe auf kleine Boote stehen für zwei beunruhigende Trends im Weißen Haus. Erstens nutzt die Regierung Trump das Militär zunehmend für routinemäßige Strafverfolgungsmaßnahmen oder die Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen. Zu Beginn seiner Amtszeit berief sich Donald Trump auf den „Alien Enemies Act” (Gesetz über ausländische Feinde). Dieses Kriegsgesetz erlaubt es dem Präsidenten, Nichtstaatsbürger aufgrund ihrer nationalen Herkunft im Falle einer Kriegserklärung oder Invasion durch eine ausländische Regierung festzunehmen und abzuschieben.
Die Regierung behauptete, die venezolanische Regierung kontrolliere die kriminelle Bande Tren de Aragua. Laut der Proklamation falle diese Bande gerade in die USA ein. Würde man diese Logik zu Ende denken, befänden sich die USA im Kriegszustand mit Venezuela. Trotz Trumps Behauptungen, er berufe sich auf Kriegsmaßnahmen, glaubt der Geheimdienst nicht, dass Tren de Aragua von der venezolanischen Regierung kontrolliert wird.
Rubio stufte auch eine Reihe weiterer lateinamerikanischer Kartelle als „ausländische terroristische Organisationen” sowie als „besonders ausgewiesene globale Terroristen” ein. Anschließend unterzeichnete Trump einen geheimen Erlass, der es dem Kriegsministerium erlaubt, militärische Maßnahmen gegen bestimmte Kartelle in Lateinamerika zu ergreifen. Trump behauptete öffentlich, dass es sich bei den Getöteten um Mitglieder von Tren de Aragua handelte. In dem gemäß der War Powers Resolution erforderlichen Bericht an den Kongress hat Trump jedoch nicht angegeben, welcher Gruppe die Personen angeblich angehörten.
Neben dem Einsatz des Militärs, um den gescheiterten „Krieg gegen die Drogen” in einen regelrechten Krieg zu verwandeln, hat das Weiße Haus auch die Spannungen mit Venezuela verschärft. Während Trumps erster Amtszeit erhob seine Regierung eine höchst zweifelhafte Anklage wegen Drogenhandels gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Im August erhöhte die Regierung Trump die Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme Maduros führen, auf 50 Millionen US-Dollar. Das ist doppelt so viel, wie einst auf Osama bin Laden ausgesetzt war. Anschließend entsandte die Trump-Regierung 4.500 Militärangehörige in die Karibik, begleitet von sieben Kriegsschiffen und einem Atom-U-Boot. Seit der ersten Bombardierung eines Bootes haben die Vereinigten Staaten F-35-Kampfflugzeuge und Reaper-Drohnen nach Puerto Rico geschickt. Laut Axios waren die USA noch nie so nah an einem bewaffneten Konflikt mit Venezuela.
Trump hat vom Kongress keine Zustimmung für militärische Maßnahmen gegen Venezuela oder Tren de Aragua erhalten. Trump begeht schlicht und einfach Mord. Drogenhandel ist eine Straftat, keine Kriegshandlung. Die Küstenwache verfügt über Protokolle zum Abfangen verdächtiger Drogenschiffe. Die Küstenwache soll das Schiff stoppen, nicht zuerst töten und dann Fragen stellen. Der Präsident kann nicht einfach jemanden töten lassen, nur weil er behauptet, dass diese Person ein Verbrechen begangen hat. Ein solches Vorgehen verstößt nicht nur gegen die in der Verfassung garantierten Rechte auf ein ordentliches Verfahren, sondern auch gegen das Völkerrecht, das außergerichtliche Tötungen verbietet.
Ermordungen, gezielte Tötungen und außergerichtliche Hinrichtungen
Die Außenpolitik der USA blickt auf eine dunkle Geschichte außergerichtlicher Hinrichtungen zurück. Während des Kalten Krieges plante die CIA zweifellos die Ermordung ausländischer Anführer. Während des Vietnamkriegs führte die CIA das Phoenix-Programm durch, ein „Programm zur Bekämpfung von Subversion”, im Rahmen dessen über 20.000 mutmaßliche Mitglieder des Vietcong durch außergerichtliche Hinrichtungen „neutralisiert” wurden. Die CIA lieferte auch die Namen mutmaßlicher Kommunisten an die irakische Baath-Partei und die indonesische Armee, in dem Wissen, dass sie Folter oder dem Tod ausgesetzt sein würden.
Nach Enthüllungen von Ermordungen der CIA erließ Präsident Gerald Ford eine Präsidialverordnung, die die Beteiligung der USA an „politischen Ermordungen” verbot. Jimmy Carter weitete das Verbot auf alle Ermordungen aus. Ronald Reagan versprach im Wahlkampf, die CIA zu entfesseln. Er hob Carters Präsidialverordnung, die die Geheimdienste einschränken sollte, auf und ersetzte sie durch eine neue Verordnung, die deren Befugnisse erweiterte. Doch obwohl Reagans Verordnung das Ergebnis der Wut der „Neuen Rechten” über Kontrollen von Missbräuchen im Bereich der nationalen Sicherheit war, behielt er das Verbot von Ermordungen bei. Bis heute ist dies die offizielle Politik der USA. Keine der Verordnungen definierte den Begriff der Ermordung, und mit etwas juristischer Kreativität gelang es der Exekutive, das Ermordungsgeschäft wieder aufzunehmen und auszuweiten.
Die Geschichte der außergerichtlichen Tötungen in den Vereinigten Staaten ist eng mit ihrer Allianz mit Israel verflochten. Während viele Staaten Attentate als politisches Mittel eingesetzt haben, war Israel ein echter Vorreiter in dieser Praxis. Obwohl die Ermordungen palästinensischer Anführer durch Israel kaum ein Geheimnis waren, gab das Land zu Beginn der Nullerjahre öffentlich bekannt, dass es ein Programm für „gezielte Tötungen” hatte. Gezielte Tötungen ist kein Begriff, der im Völkerrecht definiert ist; es handelt sich eindeutig um einen Euphemismus, der dazu dient, das Verbot außergerichtlicher Tötungen zu umgehen.
Anfangs lehnte die Regierung von George W. Bush die gezielten Tötungen durch Israel öffentlich ab. Während der demokratische Kongressabgeordnete John Conyers darauf hinwies, dass bei dieser Art von Angriffen US-Waffen eingesetzt wurden, und eine Untersuchung forderte, verfolgten andere Demokraten einen anderen Ansatz. Sie kritisierten die Ablehnung der Regierung Bush gegenüber den israelischen Ermordungen. Der spätere Präsident Joe Biden gehörte im Kongress zu den Befürwortern der gezielten Tötungen durch Israel. Und innerhalb der Regierung Bush gab es mindestens einen Dissidenten: Vizepräsident Dick Cheney machte seine Unterstützung für die israelische Politik deutlich.
Bushs Bereitschaft, Israel für gezielte Tötungen aufzurüsten, ließ die öffentliche Ablehnung seiner Regierung gegenüber dieser Vorgehensweise stets anzweifeln. Er stand ihr allerdings eindeutig positiv gegenüber. Im Jahr 2008 arbeitete die CIA direkt mit dem israelischen Mossad zusammen, um Imad Mughniyeh von der Hisbollah zu ermorden. Die Tötung erfolgte durch eine Autobombe in Syrien. Die Vereinigten Staaten argumentierten, Mughniyeh sei eine imminente Bedrohung gewesen und sie hätten daher mit seiner Tötung nicht gegen das Verbot außergerichtlicher Tötungen verstoßen.
Noch wichtiger ist, dass die USA nach dem 11. September gezielte Tötungen als Teil ihres „Kriegs gegen den Terror” einsetzten. Viele dieser Tötungen wurden mit unbemannten Drohnen durchgeführt. Die Regierung Bush holte sich von Israel operatives Fachwissen darüber, wie solche Tötungen durchzuführen sind. Und sie holte sich von Israel rechtliche Beratung darüber, wie sich gezielte Tötungen nach internationalem Recht rechtfertigen lassen.
Zwar hat George W. Bush dieses Programm ins Leben gerufen, doch Barack Obama hat es drastisch ausgeweitet. Mit einer der schockierendsten autoritären Maßnahmen eines US-Präsidenten ordnete Obama die Hinrichtung des US-Bürgers Anwar al-Awlaki durch eine Drohne an. Awlaki wurde beschuldigt, ein Propagandist der Al-Qaida zu sein. Nach den Gesetzen des bewaffneten Konflikts ist ein Propagandist jedoch kein militärisches Ziel. Die Tötung eines US-Bürgers durch Obama löste eine öffentliche Kontroverse aus. Infolgedessen veröffentlichte die Regierung ein stark zensiertes Rechtsgutachten, in dem die Tötung gerechtfertigt wurde. In einem zensierten Abschnitt wurde ein israelisches Gerichtsurteil zitiert, wonach solche gezielten Tötungen nach internationalem Recht zulässig seien.
Das Ermordungsprogramm von Bush und Obama wirkt fort in Trumps außergerichtlicher Hinrichtung mutmaßlicher Kartellmitglieder in der Karibik. Obwohl dies in Trumps dürftigem Bericht an den Kongress nicht erwähnt wird, beruht ein Großteil der Logik hinter dem Töten darauf, dass frühere Präsidenten während des globalen Krieges gegen den Terror die Ermordung von „Terroristen” angeordnet hatten.
Da Trump venezolanische Banden als Terroristen bezeichnet hat, kann er Gewalt gegen sie anwenden, so wie Obama seinen Drohnenkrieg über Grenzen hinweg geführt hat. Zwar sollten wir das Drohnenprogramm nicht beschönigen, da es ein mörderischer Verstoß gegen die Grundrechte (Bill of Rights) und das Völkerrecht war, doch es gibt einen entscheidenden rechtlichen Unterschied. Bush und Obama behaupteten, die Vereinigten Staaten befänden sich in einem internationalen bewaffneten Konflikt mit den Taliban, Al-Qaida und „verbündeten Kräften”. Dieser Konflikt war das Ergebnis einer Genehmigung des Kongresses zur Anwendung von Gewalt gegen diejenigen Personen und Nationen, die die Anschläge vom 11. September geplant oder unterstützt hatten.
Es gibt keinen internationalen bewaffneten Konflikt zwischen den USA und Drogenschmugglern. Und der Kongress hat einer solchen Militäraktion nicht zugestimmt. Die Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt aus dem Jahr 2001 war übermäßig weit gefasst, die Präsidenten haben sie weit über jede logische Auslegung ihres Geltungsbereichs hinaus ausgedehnt, und die Tötungen durch Drohnen waren Ermordungen und keine rechtmäßigen Akte der Selbstverteidigung. Dennoch ist Trumps Vorgehen hier eine Ausweitung einer ohnehin schon beunruhigenden Praxis.
Die Einstufung der Kartelle als terroristische Vereinigungen durch Trump stützt sich auf zwei Gesetze: das Gesetz über internationale wirtschaftliche Notstandsbefugnisse sowie das Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Seit einer Verordnung von Bill Clinton aus dem Jahr 1995 nutzen Präsidenten das Gesetz über internationale wirtschaftliche Notstandsbefugnisse, um Sanktionen zu verhängen und Finanztransaktionen mutmaßlicher Terroristen zu blockieren. Clinton wandte diese Einstufung zunächst auf „Terroristen” an, die „den Friedensprozess im Nahen Osten bedrohten”. Obwohl Clintons Verordnung weiterhin in Kraft ist, weitete Bush mit einer eigenen Verordnung diesen Anwendungsrahmen auf Terroristen im Allgemeinen aus. Auf Grundlage dieser Verordnung stufte die Regierung Trump Drogenkartelle als „besonders ausgewiesene globale Terroristen” ein.
Auf Drängen Clintons verabschiedete der Kongress 1997 das von den Republikanern verfasste Gesetz zur Terrorismusbekämpfung und wirksamen Todesstrafe (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act). Das Gesetz änderte das Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (Immigration and Nationality Act) dahingehend, dass der Außenminister ausländische Gruppen einseitig als „ausländische terroristische Organisationen” (Foreign Terrorist Organizations) einstufen konnte. Zudem stellte das Gesetz zur Terrorismusbekämpfung und wirksamen Todesstrafe die „materielle Unterstützung” einer als ausländische terroristische Organisation eingestuften Gruppe unter Strafe.
Zwar ist es nach beiden Gesetzen strafbar, einer auf der schwarzen Liste stehenden Terrororganisation Unterstützung oder Dienstleistungen zu gewähren, doch die Einstufung selbst ist nicht das Ergebnis eines Strafverfahrens. Die Bezeichnung „ausländische terroristische Organisation” kann nur auf ausländische Organisationen angewendet werden. Die Einstufung gemäß dem Gesetz über internationale wirtschaftliche Notstandsbefugnisse kann auf US-amerikanische Gruppen oder sogar Einzelpersonen angewendet werden. Der erste US-Bürger, der gemäß diesem Gesetz als Terrorist eingestuft wurde, wurde erst Jahre später wegen einer Straftat angeklagt. Und selbst nachdem er von allen Terrorismusvorwürfen freigesprochen worden war, blieb er weiterhin sanktioniert, bis eine Klage eingereicht wurde.
Nach Trumps Logik könnte jemand, der von Terrorismusvorwürfen freigesprochen wurde, allein aufgrund einer missbräuchlichen, weit gefassten Bezeichnung vom Präsidenten ermordet werden. Die Gesetze geben jedoch keine solche Befugnis. Sie waren eine Reaktion auf die Panik Mitte der 1990er-Jahre, dass die strengen Schutzbestimmungen des Ersten Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten das Land zu einem Zufluchtsort für die Finanzierung von Terroristen gemacht hätten. Die Gesetze waren zwar weit gefasst und missbräuchlich, aber sie waren keine Ermächtigungen zur Anwendung militärischer Gewalt, sondern strafrechtliche Verbote der materiellen Unterstützung von auf der schwarzen Liste stehenden Gruppen.
Krieg gegen Drogen oder Regimewechsel?
Trumps Mordakt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela zunehmen – Spannungen, für die das Weiße Haus die Verantwortung trägt. All dies basiert auf Behauptungen über die Rolle der venezolanischen Regierung im internationalen Drogenhandel. Die US-Regierung geht sogar so weit, zu behaupten, Maduro sei der Chef des „Sonnenkartells”. All diese Behauptungen sind, gelinde gesagt, höchst zweifelhaft. Experten haben nicht nur festgestellt, dass Venezuela keine wichtige Rolle im Drogenhandel spielt, sondern auch, dass das „Sonnenkartell” nicht mal existiert. Dies wirft Fragen zu den Motiven der Trump-Regierung für das militärische Aufgebot auf.
Seit fast zwei Jahrzehnten versuchen aufeinanderfolgende US-Regierungen, die linken Regierungen von Hugo Chávez und nun Nicolás Maduro zu untergraben oder gar zu stürzen. Während seiner ersten Amtszeit verschärfte Trump die Sanktionen gegen das Land, was laut dem Center for Economic and Policy Research zum Tod von 40.000 Menschen führte. Die Sanktionen haben auch zu einer Flüchtlingskrise beigetragen, die Trump zynisch als Teil seiner fremdenfeindlichen Dämonisierung von Migranten ausnutzte. Während seiner ersten Amtszeit erkannte Trump auch eine alternative venezolanische Regierung an, die keine tatsächliche politische Macht hatte. Diese beschlagnahmte dann die venezolanische Botschaft in Washington von der real existierenden Regierung Maduro und übergab sie der von Washington unterstützten fiktiven Regierung.
All dies hatte nichts mit Drogenbekämpfung zu tun, sondern mit den Fantasien von Hardliner-Neokonservativen der Regierung Trump über einen Regimewechsel, wie John Bolton und Elliott Abrams. Trump hat sich zwar dramatisch mit Bolton überworfen, aber einer der größten Befürworter dieser Politik war damals Senator Marco Rubio. Rubio ist jetzt Trumps Außenminister, und es ist klar, dass er nach wie vor fanatisch darauf aus ist, die Regierung Venezuelas zu stürzen.
Trumps Kriegsminister Pete Hegseth hat deutlich gemacht, dass ein Regimewechsel nicht ausgeschlossen sei. Sollte Trumps angeblicher Krieg gegen die Drogen tatsächlich zu einer umfassenden Aktion zur Absetzung einer von Washington unliebsamen Regierung führen, wäre dies kaum der erste Krieg der USA, der unter falschen Vorwänden begonnen wurde.
Lügen über einen Angriff Nordvietnams auf ein US-Schiff im Golf von Tonkin oder über irakische Massenvernichtungswaffen und Verbindungen zum 11. September ebneten den Weg für zwei der katastrophalsten Kriege der USA in der Nachkriegszeit. Und unter dem erklärten Ziel, den panamaischen Diktator Manuel Noriega – einen ehemaligen CIA-Mitarbeiter, dessen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten sich verschlechtert hatte – wegen Drogenhandels zu verhaften, marschierten die USA in Panama ein.
Die Invasion, die von der Regierung George H. W. Bush als „Operation Just Cause” (Operation gerechte Sache) bezeichnet wurde, forderte 3.500 Todesopfer unter der panamaischen Bevölkerung. Die erneuten Bemühungen, Maduro wegen höchst fragwürdiger Drogenhandelsvorwürfe zu verhaften, begleitet von einem militärischen Aufgebot, haben die berechtigte Befürchtung geweckt, dass die Regierung Trump ein altes Drehbuch gerade wieder aufleben lässt.
Militarismus und Trumps Drohung
Ob Trump die Vereinigten Staaten nun in einen umfassenderen Krieg zum Regimewechsel mit Venezuela führt oder einfach nur die Praxis der gezielten Tötungen im Rahmen des „Kriegs gegen den Terror” zu einem Markenzeichen des „Kriegs gegen die Drogen” macht – diese militaristischen Handlungen stellen einige der größten Gefahren von Trumps zweiter Amtszeit dar. Die Bedrohung durch Trump ist real, aber sie ist nicht einzigartig. Sie wurzelt im Erbe des US-amerikanischen Militarismus und eines Staats der nationalen Sicherheit, der sich das Recht herausnimmt, ohne Gerichtsverfahren über Grenzen hinweg zu töten.
Dennoch haben viele liberale Gegner Trumps versucht, sich seinen autoritären Tendenzen zu widersetzen, während sie gleichzeitig die Augen vor dem Militarismus verschlossen haben. Während der Wahl 2024 versuchte Trump, sich gegenüber einer kriegsmüden Öffentlichkeit fälschlicherweise als Kriegsgegner darzustellen. Anstatt auf seine Lügen hinzuweisen, präsentierten sich seine Gegner in den Wahlkampagnen von Biden und Kamala Harris als bessere Verwalter des amerikanischen Leviathans der nationalen Sicherheit. Sie schalteten Anzeigen, in denen sie damit prahlten, wie sie den Waffenfluss in den festgefahrenen Krieg zwischen der Ukraine und Russland aufrechterhielten, paradierten mit Liz Cheney herum, warben mit der Unterstützung von Dick Cheney, versprachen die tödlichste Streitmacht der Welt und ignorierten die berechtigte Wut ihrer eigenen Basis über ihre Rolle bei der Ermöglichung eines Völkermords in Gaza. Und zu keinem Zeitpunkt während Bidens vierjähriger Amtszeit versuchten sie, seine Sanktionen gegen Venezuela aufzuheben, die eine humanitäre Katastrophe ausgelöst hatten.
Jetzt ist Trump wieder an der Macht. Und er hat die Vereinigten Staaten an den Rand eines Krieges gebracht und erweitert die ohnehin schon königlichen Kriegsbefugnisse des Präsidenten. Es gibt kein Gegengift gegen seine autoritäre Bedrohung, die den nationalen Sicherheitsstaat unangetastet lässt.
Über den Autor: Chip Gibbons ist Direktor von Defending Rights & Dissent. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die Geschichte des FBI, das das Verhältnis zwischen innenpolitischer Überwachung und dem Entstehen des US-Staates der nationalen Sicherheit untersucht.
Übersetzung: Hans Weber, Amerika21.
Titelbild: U.S. Marine Corps / Christopher Lape
Venezuela versperrt den USA das Tor zum Hinterhof
Brief an Trump: Venezuelas Präsident ruft zum Dialog auf und weist Vorwürfe des Drogenhandels zurück