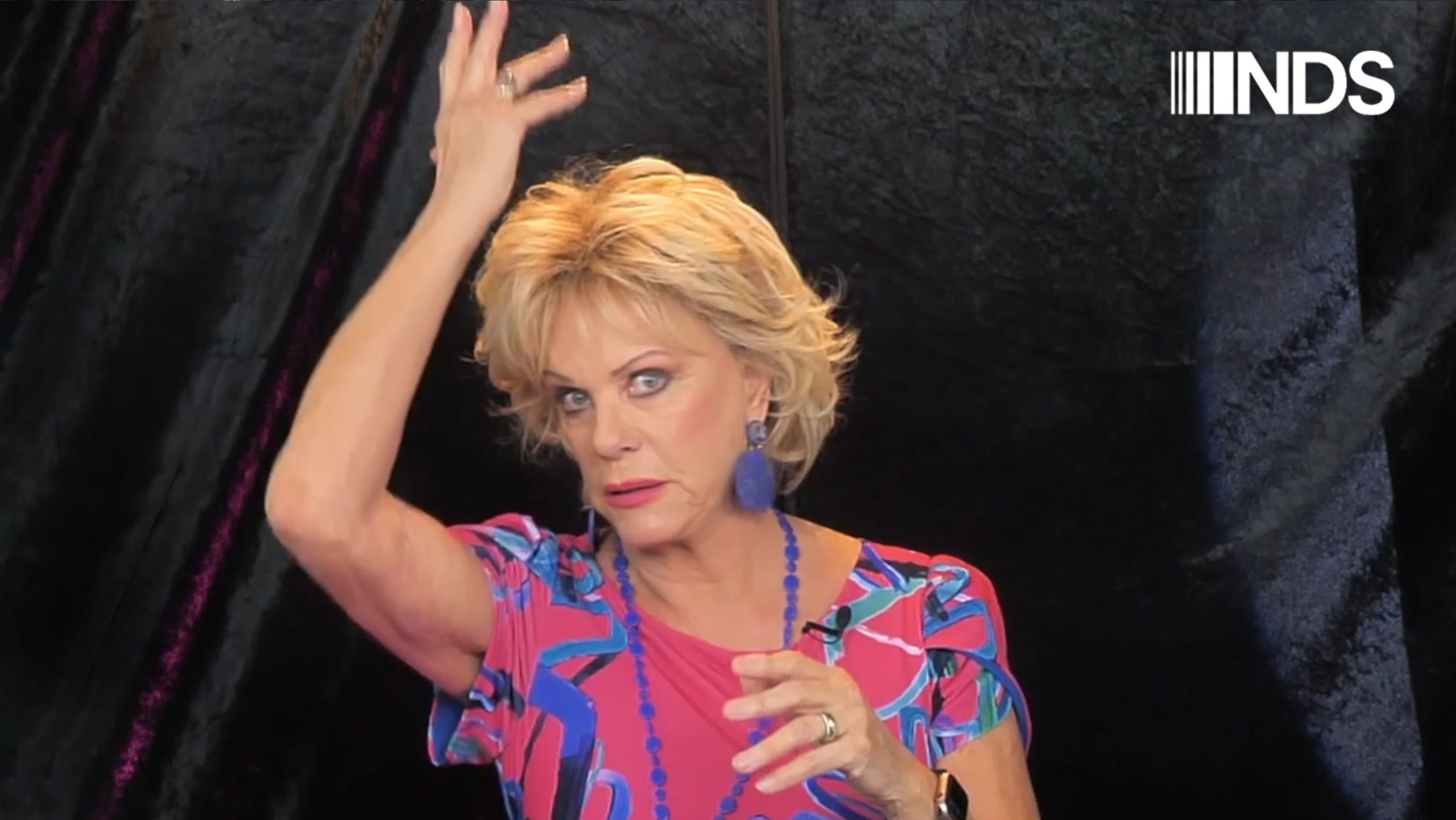Dass der Westen und seine Verbündeten während der russischen Revolution aktiv in den Bürgerkrieg eingegriffen haben, ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Wenn man sich überhaupt noch der eigenen Aggressionen gegen Russland bewusst ist, dann denkt man an Hitler, allenfalls noch an Napoleon. Diese westliche Intervention von 1918/1919 ist auch im Kontext des aktuellen Konflikts in der Ukraine von Interesse, und das nicht nur, weil es erneut eine „heiße“ Konfrontation zwischen dem Westen und Russland gibt. Es gibt Kontinuitäten (westlicher Expansionismus, russophobe Eliten) und Brüche (das politische Bewusstsein der Bevölkerung war vor 100 Jahren offenbar weiter entwickelt als heute). Und wir erfahren, dass es in den osteuropäischen Ländern eine Arbeiter- und Bauernschaft gab, die die Revolution unterstützte. Die Intervention scheiterte, aber der Westen gab seine Ziele nicht auf. Von Jacques R. Pauwels[1], Übersetzung aus dem Englischen von Heiner Biewer.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
In ganz Europa hatte der Erste Weltkrieg bereits 1917 eine potenziell revolutionäre Situation geschaffen. In den Ländern, in denen die Regierungen weiterhin die herkömmlichen Eliten vertraten, wie es 1914 der Fall gewesen war, wurde versucht, die Verwirklichung dieses revolutionären Potenzials durch Repressionen und/oder Zugeständnisse zu verhindern. In Russland jedoch brach die Revolution nicht nur aus, sondern sie war auch erfolgreich, und die Bolschewiki begannen mit dem Aufbau der ersten sozialistischen Gesellschaft der Welt. Es war ein Experiment, für das die Eliten der anderen Länder keinerlei Sympathie empfanden; im Gegenteil, sie hofften inständig, dass dieses Projekt in einem trostlosen Fiasko enden würde.
In elitären Kreisen in London, Paris und anderswo war man davon überzeugt, dass das kühne Experiment der Bolschewiki unweigerlich scheitern würde. Aber um sicherzugehen, beschloss man, Truppen nach Russland zu schicken, um die „weißen“ Konterrevolutionäre gegen die bolschewistischen „Roten“ in einem Konflikt zu unterstützen, der sich zu einem großen, langen und blutigen Bürgerkrieg entwickeln sollte. Eine erste Welle alliierter Truppen traf im April 1918 in Russland ein, als britische und japanische Soldaten in Wladiwostok an Land gingen. Sie nahmen Kontakt mit den „Weißen“ auf, die sich bereits in einem ausgewachsenen Krieg gegen die Bolschewiki befanden. Allein die Briten schickten 40.000 Mann nach Russland.
Im selben Frühjahr entsandte der damalige Kriegsminister Churchill ein Expeditionskorps nach Murmansk im Norden Russlands, um die Truppen des „weißen“ Generals Koltschak zu unterstützen, in der Hoffnung, dass dies dazu beitragen würde, die bolschewistischen Machthaber durch eine den Briten wohlgesonnene Regierung zu ersetzen. Andere Länder schickten kleinere Truppenkontingente, darunter Frankreich, die Vereinigten Staaten (15.000 Mann), Japan, Italien, Rumänien, Serbien und Griechenland. In einigen Fällen wurden die alliierten Truppen an den russischen Grenzen in Kämpfe gegen die Deutschen und die Osmanen verwickelt, aber es war klar, dass sie nicht zu diesem Zweck gekommen waren, sondern um das bolschewistische Regime zu stürzen und „das bolschewistische Baby in seiner Wiege zu erwürgen“, wie sich Churchill „diplomatisch“ ausdrückte. Insbesondere die Briten hofften, einige attraktive Teile eines russischen Staates zu ergattern, der ähnlich wie das Osmanische Reich zu zerfallen drohte. Dies erklärt, warum eine britische Einheit von Mesopotamien bis an die Küste des Kaspischen Meeres marschierte, und zwar in die ölreichen Gebiete um Baku, die Hauptstadt des heutigen Aserbaidschan. Wie der Erste Weltkrieg selbst diente auch die Intervention der Alliierten in Russland sowohl der Bekämpfung der Revolution als auch der Verwirklichung imperialistischer Ziele.
In Russland hatte der Krieg nicht nur günstige Bedingungen für eine soziale Revolution geschaffen, sondern auch in einigen Teilen dieses riesigen Landes zu nationalen Revolutionen einer Reihe von ethnischen Minderheiten geführt. Solche nationalen Bewegungen waren bereits während des Krieges entstanden und gehörten meist zur rechten, konservativen, rassistischen und antisemitischen Variante des Nationalismus. Die politische und militärische Elite Deutschlands erkannte in diesen Bewegungen enge ideologische Verwandte und potenzielle Verbündete im Krieg gegen Russland. (Lenin und die Bolschewiki hingegen wurden im Krieg gegen Russland als nützlich angesehen, aber ideologisch waren diese revolutionären Russen Antipoden des reaktionären deutschen Regimes.) Die Deutschen unterstützten die finnischen, baltischen, ukrainischen und anderen Nationalisten nicht aus ideologischer Sympathie, sondern weil sie dazu benutzt werden konnten, Russland zu schwächen; sie taten es auch, weil sie hofften, in Ost- und Nordeuropa deutsche Satellitenstaaten aus dem Boden zu stampfen, vorzugsweise Monarchien mit einem Spross einer deutschen Adelsfamilie als „Souverän“. Der Vertrag von Brest-Litowsk erwies sich als eine Gelegenheit, eine Reihe solcher Staaten zu schaffen. Vom 11. Juli bis zum 2. November 1918 konnte sich ein deutscher Adliger namens Wilhelm (II) Karl Florestan Gero Crescentius, Herzog von Urach und Graf von Württemberg, unter dem Namen Mindaugas II. als König von Litauen feiern lassen.
Mit dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 war Deutschland dazu verurteilt, in Ost- und Nordeuropa von der Bildfläche zu verschwinden, und damit war auch der Traum von der deutschen Hegemonie in diesem Gebiet ausgeträumt. Allerdings erlaubte Artikel 12 des Waffenstillstands den deutschen Truppen, so lange in Russland, im Baltikum und anderswo in Osteuropa zu bleiben, wie es die Alliierten für notwendig erachteten; mit anderen Worten, solange sie für den Kampf gegen die Bolschewiki nützlich blieben, einen Kampf, den die Deutschen auch führten. Britische und französische Führer wie Lloyd George und Foch betrachteten das revolutionäre Russland fortan als einen gefährlicheren Feind als Deutschland. Die nationalen Bewegungen im Baltikum, Finnland, Polen und anderswo waren nun vollständig in den russischen Bürgerkrieg verwickelt, und die Alliierten traten als – auch militärische – Unterstützer an die Stelle Deutschlands, solange diese Bewegungen die „Roten“ und nicht die „Weißen“ bekämpften. Letzteres war durchaus häufiger der Fall: viele osteuropäische Ländereien, die früher zum Zarenreich gehörten, wurden von den russischen „Weißen“ ebenso wie von polnischen, litauischen, ukrainischen und anderen Nationalisten beansprucht.
In allen Ländern, die nach dem Zusammenbruch des Zarenreichs aus den Staubwolken aufstiegen, gab es im Wesentlichen zwei Gruppen von Menschen. Erstens Arbeiter, Bauern und andere Angehörige der unteren Klassen, die eine soziale Revolution befürworteten und die Bolschewiki unterstützten. Sie waren bereit, sich mit einer Art Autonomie für ihre eigene ethnisch-sprachliche Minderheit innerhalb eines neuen multiethnischen und mehrsprachigen Staates zu begnügen, welcher zwangsläufig von seiner russischen Komponente dominiert werden würde, dem Staat also, der an die Stelle des ehemaligen Zarenreichs treten und als Sowjetunion bekannt werden sollte. Zweitens die Mehrheit, aber nicht alle, der Mitglieder der alten aristokratischen und bürgerlichen Eliten und des Kleinbürgertums, die gegen eine soziale Revolution waren und daher die Bolschewiki verabscheuten und bekämpften und die völlige Unabhängigkeit von dem von diesen geschaffenen Staat wollten. Ihr Nationalismus war ein typischer Nationalismus des 19. Jahrhunderts, rechts und konservativ, eng verbunden mit einer ethnischen Gruppe, einer Sprache, einer Religion und einer angeblich glorreichen, meist mythischen Vergangenheit, von der man sich eine Wiedergeburt durch eine nationale Revolution versprach. Auch in Finnland, Estland, der Ukraine und anderswo brachen Bürgerkriege zwischen „Weißen“ und „Roten“ aus.
Wenn die „Weißen“ vielfach als Sieger aus diesen Konflikten hervorgingen und entschlossen antibolschewistische und antirussische Staaten errichten konnten, dann nicht nur, weil die Bolschewiki im russischen Kernland selbst lange mit dem Rücken zur Wand standen und daher kaum in der Lage waren, ihre „roten“ Genossen im Baltikum und anderswo in der Peripherie des ehemaligen Zarenreichs zu unterstützen, sondern auch, weil erst die Deutschen und dann die Alliierten – insbesondere die Briten – manu militari zugunsten der „Weißen“ eingriffen. So tauchte Ende November 1918 ein Geschwader der Royal Navy unter dem Kommando von Admiral Edwyn Alexander-Sinclair (und später von Admiral Walter Cowan) in der Ostsee auf, um die estnischen und lettischen „Weißen“ mit Waffen zu versorgen und sie im Kampf gegen ihre „roten“ Landsleute sowie die bolschewistischen russischen Truppen zu unterstützen. Die Briten versenkten eine Reihe von Schiffen der russischen Flotte und blockierten den Rest der Flotte in ihrem Stützpunkt, Kronstadt. In Finnland hatten deutsche Truppen bereits im Frühjahr 1918 den dortigen „Weißen“ zum Sieg verholfen und sie in die Lage versetzt, die Unabhängigkeit ihres Landes zu erklären.
Es war eindeutig die Absicht der „patrizischen“ Entscheidungsträger in London, Paris, Washington usw., den Sieg der „Weißen“ auf Kosten der „Roten“ auch im Bürgerkrieg in Russland selbst zu sichern und damit das bolschewistische Unternehmen zu beenden – ein groß angelegtes Experiment, für das sich zu viele Briten, Franzosen, Amerikaner und „Plebejer“ anderer Länder interessierten und begeisterten, was ihren „Herrschaften“ missfiel. In einer Note an Clemenceau im Frühjahr 1919 drückte Lloyd George seine Besorgnis darüber aus, dass „ganz Europa vom Geist der Revolution erfüllt ist“ und dass „unter den Arbeitern nicht nur ein tiefes Gefühl der Unzufriedenheit, sondern auch des Zorns und der Revolte gegen die Kriegsbedingungen herrscht. (…) Die gesamte bestehende Ordnung in ihren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten wird von den Massen der Bevölkerung von einem Ende Europas bis zum anderen in Frage gestellt.“
Die Intervention der Alliierten in Russland war jedoch kontraproduktiv, da die ausländische Unterstützung die konterrevolutionären Kräfte in den Augen zahlloser Russen diskreditierte, die die Bolschewiki zunehmend als die wahren russischen Patrioten ansahen und sie folglich unterstützten. In vielerlei Hinsicht war die bolschewistische Revolution zugleich eine nationalrussische Revolution, ein Kampf um das Überleben, die Unabhängigkeit und die Würde von Mütterchen Russland, zunächst gegen die Deutschen, dann gegen die alliierten Truppen, die von allen Seiten in das Land eindrangen und sich aufführten, „als wären sie in Zentralafrika“ (in diesem Punkt ähneln die Bolschewiki den Jakobinern der Französischen Revolution, die gleichzeitig für die Revolution und für Frankreich gekämpft hatten). Aus diesem Grund konnten sich die Bolschewiki auf die Unterstützung zahlreicher bürgerlicher und sogar aristokratischer Nationalisten stützen, eine Unterstützung, die wahrscheinlich ein entscheidender Faktor für ihren Sieg im Bürgerkrieg gegen die Kombination aus „Weißen“ und Alliierten war. Selbst der berühmte General Brussilow, ein Adliger, unterstützte die „Roten“. „Das Bewusstsein meiner Pflicht gegenüber der [russischen] Nation“, erklärte er, „veranlasste mich, meinen natürlichen sozialen Instinkten nicht zu gehorchen.“ In jedem Fall waren die „Weißen“ nichts anderes als „ein Mikrokosmos der herrschenden und regierenden Klassen des alten russischen Regimes – Offiziere, Landbesitzer, Kirchenmänner – mit minimaler Unterstützung durch das Volk“, so Arno Mayer.[2] Außerdem waren sie korrupt, und ein großer Teil des Geldes, das die Alliierten ihnen schickten, verschwand in ihren Taschen.
Wenn die Intervention der Alliierten in Russland, die manchmal als „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ angepriesen wurde, zum Scheitern verurteilt war, dann auch deshalb, weil sie von zahllosen Soldaten und Zivilisten in Großbritannien, Frankreich und anderswo im Westen entschieden abgelehnt wurde. Ihre Parole lautete „Hände weg von Russland!“. Die britischen Soldaten, die nach dem Waffenstillstand vom November 1918 nicht demobilisiert worden waren und nach Russland verschifft werden sollten, protestierten und organisierten Meutereien, zum Beispiel im Januar 1919 in Dover, Calais und anderen Häfen am Ärmelkanal. Im selben Monat kam es in Glasgow zu einer Reihe von Streiks, die u.a. zum Ziel hatten, die Regierung zur Aufgabe ihrer Interventionspolitik gegenüber Russland zu zwingen. Im März 1919 randalierten kanadische Soldaten in einem Lager in Ryl in Wales, fünf Männer wurden getötet und 23 verwundet; später kam es im selben Jahr in anderen Armeelagern zu ähnlichen Unruhen. Diese Unruhen spiegelten sicherlich die Ungeduld der Soldaten wider, entlassen zu werden und nach Hause zurückzukehren, aber sie zeigten auch, dass allzu viele der Soldaten nicht für einen zeitlich unbestimmten Einsatz im fernen Russland geeignet waren.
In Frankreich forderten unterdessen Streikende in Paris lautstark ein Ende der bewaffneten Intervention in Russland, und Truppen, die bereits in Russland waren, machten deutlich, dass sie nicht gegen die Bolschewiki kämpfen, sondern nach Hause zurückkehren wollten. Im Februar, März und April 1919 kam es zu Meutereien und Desertionen bei den im Hafen von Odessa stationierten französischen Truppen und bei den britischen Streitkräften im nördlichen Bezirk Murmansk, und einige der Briten wechselten sogar die Seiten und schlossen sich den Bolschewiken an. „Soldaten, die Verdun und die Schlacht an der Marne überlebt hatten, wollten nicht in den Ebenen Russlands kämpfen“, so die säuerliche Bemerkung eines französischen Offiziers. Im US-Kontingent griffen zahlreiche Männer zu Selbstverstümmelungen, um die Heimkehr zu erreichen. Die alliierten Soldaten sympathisierten immer mehr mit den russischen Revolutionären; sie wurden immer mehr von dem Bolschewismus „kontaminiert“, den sie eigentlich bekämpfen sollten. Und so kam es, dass im Frühjahr 1919 die Franzosen, Briten, Kanadier, Amerikaner, Italiener und andere ausländische Truppen unrühmlich aus Russland abgezogen werden mussten.
Die westlichen Eliten erwiesen sich als unfähig, die Bolschewiki durch eine bewaffnete Intervention zu besiegen. Sie änderten daher ihren Kurs und unterstützten die neuen Staaten, die aus den westlichen Gebieten des früheren Zarenreichs hervorgingen, wie etwa Polen und die baltischen Länder, politisch und militärisch in großzügiger Weise. Diese neuen Staaten waren ausnahmslos das Ergebnis nationaler Revolutionen, die von reaktionären, allzu oft antisemitisch gefärbten Spielarten des Nationalismus inspiriert waren, und sie wurden von den Überlebenden der alten Eliten beherrscht, darunter Großgrundbesitzer und Generäle aristokratischer Herkunft, die „nationalen“ christlichen Kirchen und die Industriellen. Mit wenigen Ausnahmen wie der Tschechoslowakei waren sie keine Demokratien, sondern wurden von autoritären Regimen regiert, an deren Spitze in der Regel ein hochrangiger Militär adliger Herkunft stand, wie beispielsweise Horthy in Ungarn, Mannerheim in Finnland und Pilsudski in Polen. Der unverblümte Antibolschewismus dieser neuen Staaten wurde nur noch von ihrer antirussischen Gesinnung übertroffen. Allerdings gelang es den Bolschewiki, einige Gebiete an der Peripherie des ehemaligen Zarenreichs zurückzuerobern, zum Beispiel die Ukraine.
Das Ergebnis dieser verwirrenden Gemengelage von Konflikten war eine Art Unentschieden: Die Bolschewiki triumphierten in Russland und bis in die westliche Ukraine, aber antibolschewistische, antirussische Nationalisten mit großen und gegensätzlichen territorialen Ambitionen setzten sich in Gebieten weiter westlich und nördlich durch, insbesondere in Polen, den baltischen Staaten und Finnland. Es war ein Arrangement, das niemanden zufriedenstellte, aber letztlich von allen akzeptiert wurde – wenn auch eindeutig nur für begrenzte Zeit. So wurde mit Hilfe der Westmächte ein Cordon sanitaire aus einer Reihe von feindlichen Staaten um das revolutionäre Russland errichtet, in der Hoffnung, damit „den Bolschewismus auf Russland zu begrenzen“, wie Margaret MacMillan schrieb. Das war vorerst alles, was der Westen tun konnte, aber der Ehrgeiz, dem revolutionären Experiment in Russland früher oder später ein Ende zu setzen, blieb in London, Paris und Washington sehr lebendig. Lange Zeit hofften die westlichen Führer, dass die russische Revolution von selbst zusammenbrechen würde, was jedoch nicht geschah. Später, in den 1930er-Jahren, hofften sie, dass Nazi-Deutschland die Aufgabe übernehmen würde, die Revolution in ihrem Schlupfwinkel, der Sowjetunion, zu zerstören; deshalb ließen sie zu, dass Hitler Deutschland remilitarisierte, und sie ermutigten ihn dazu durch ihre berüchtigte „Beschwichtigungspolitik“.
Dieser Artikel ist im englischen Original auf Counterpunch erschienen.
Titelbild: Admiral Alexander Koltschak (sitzend) und der britische General Alfred Knox (hinter Koltschak) beobachten eine Militärübung, 1919, Public Domain
[«1] Jacques R. Pauwels ist ein belgischer Historiker, der eine Reihe von Büchern vor allem zum Ersten und Zweiten Weltkrieg veröffentlicht hat. Hierzu zählt u.a. die Trilogie „The Great Class War“ (Der große Klassenkrieg, über den 1. Weltkrieg), „Big Business and Hitler“ – Die Großkonzerne und Hitler – sowie „The Myth of the Good War“ – Der Mythos vom guten Krieg (Letzteres in deutscher Übersetzung erhältlich beim Verlag PapyRossa).
[«2] Mayer ist ein US-Historiker luxemburgischer Herkunft