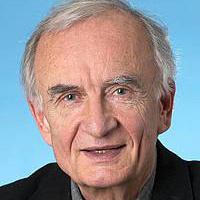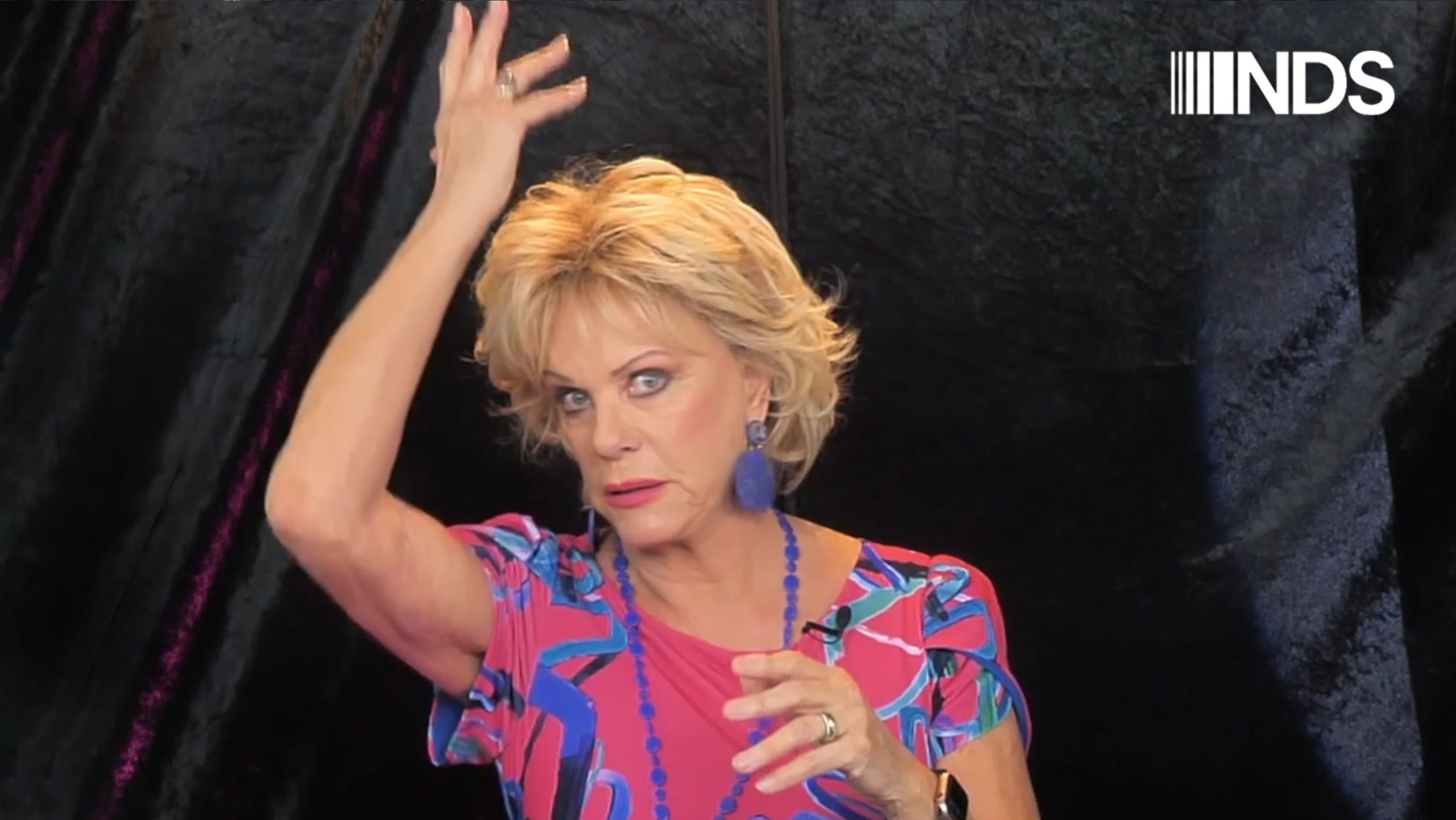Die israelische Armee (IDF) jagt immer noch die letzten Mitglieder der Hamas, auch um den Preis unzähliger ziviler Toter, Verletzter, Vertreibungen und der Vernichtung aller Lebensgrundlagen der palästinensischen Bevölkerung. Die Hamas hat sich zwar seit Wochen für einen mehrjährigen Waffenstillstand mit gleichzeitiger Überstellung der Geiseln und Versorgung der hungernden Bevölkerung in Gaza ausgesprochen. Doch in den Augen Trumps und Netanjahus will die Organisation keinen Frieden. Ein Waffenstillstand ist derzeit nicht in Sicht, denn Netanjahu bereitet die totale militärische Einnahme Gazas vor. Von Norman Paech.
Die Hamas gilt zumindest in der Vorstellung der westlichen Regierungen und ihrer Medien als Terrororganisation, da ihr Ziel die Vernichtung Israels sei, und das nicht erst seit dem 7. Oktober 2023. Sie verfolge dieses Ziel seit ihrer Gründung im Jahr 1987 unmittelbar nach der ersten Intifada mit Terroranschlägen und illegaler Gewalt. Auch in der internationalen Öffentlichkeit hat sich dieses Bild einer Terrororganisation verfestigt, jenseits von Recht und Gesetz. Ihre Verfolgung und Vernichtung bis auf den letzten Mann sei daher das Gebot der Verteidigung und des Überlebens des Staates Israel.
Wir kennen diese Stigmatisierung aus den Zeiten des antikolonialen Kampfes der sechziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, als sich die Befreiungsbewegungen vorwiegend in Afrika und Asien gegen die koloniale Herrschaft mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzten und schließlich gewannen. Und dies nicht nur auf dem Kriegsschauplatz, sondern schließlich auch in der UNO. Ob ANC (African National Congress, Südafrika), SWAPO (South West Africa People’s Organisation, Süd-West Afrika), MPLA (Movimento Popular de Libertacao de Angola), Frelimo (Frente de Libertacao de Mocambique), FLN (Front de Liberation National, Algerien) oder PLO (Palestine Liberation Organisation), sie alle wurden in der westlichen Staatenwelt, noch lange nach ihrer Anerkennung in der UNO als Befreiungsbewegungen, als Terrororganisationen diskriminiert. Das endete erst mit der Übernahme der Macht in den befreiten Staaten und dem Wechsel ihrer Führer aus dem Versteck in die Regierung.
Nur noch wenige Territorien befinden sich unter fremder, kolonialer Besetzung, die von einer nationalen Bewegung auch mit Mitteln der Gewalt bekämpft wird, wie etwa in der Westsahara der Kampf der Frente Polisario – oder auch in Gaza der Kampf der Hamas, nachdem sich die PLO auf eine Art Kooperation mit der Besatzungsmacht zurückgezogen hat. Die Frage stellt sich also, welchen völkerrechtlichen Status die Hamas (harakat almuqawama al-islamya) hat. Können sich ihre Kämpfer z.B. auf den Kombattantenstatus gem. Art. 35 ff. Erstes Zusatzprotokoll (ZPI) von 1977 berufen oder sind es schlicht Terroristen, die mit dem nationalen Strafrecht Israels verfolgt und abgeurteilt werden können?
Die Hamas
Dazu zunächst einige Fakten. Wie bereits erwähnt, spielt die Feststellung, die Hamas wolle den Staat Israel vernichten, eine zentrale Rolle für ihre Qualifizierung als Terrororganisation. In ihrer Charta von 1988 waren in der Tat neben der Befreiung Palästinas die Vernichtung Israels, die Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung und das Bekenntnis zu einem muslimischen Staat und zum Jihad die zentralen Aussagen, verbunden mit antisemitischen Passagen. Als ein jüdischer Siedler im Jahr 1994 29 palästinensische Muslime in der Abraham-Moschee in Hebron tötete, setzte die Hamas Selbstmordattentäter gegen Zivilisten ein. Sie festigte damit ihren Ruf als Terrororganisation, da der Angriff auf Zivilpersonen absolut verboten ist und ein Kriegsverbrechen darstellt.[1] Mit der Freilassung eines ihrer Gründer und prominentesten Führers Ahmad Yasin im Jahr 1997 durch einen Gefangenenaustausch aus der israelischen Haft gab sie diese Form des Kampfes wieder auf und mäßigte ihre Strategie. Bereits im Wahlkampf 2005/06 nach dem Rückzug der Siedler und der israelischen Armee aus Gaza ließ die Führung der Hamas erkennen, dass sie mit der Zwei-Staaten-Lösung einverstanden sei, wenn Israel die Grüne Linie als ihre Staatsgrenze und die Souveränität eines palästinensischen Staates anerkenne. Dieses Bekenntnis wurde dann in der neuen Charta der Hamas von 2017[2] ausdrücklich festgehalten. Seitdem hat die Hamas bis in die Gegenwart immer wieder betont, dass ihr Kampf ausschließlich die Befreiung von der israelischen Besatzung erreichen wolle.[3]
Das Recht auf Selbstbestimmung
Völkerrechtliche Basis dieses Kampfes ist dementsprechend das Recht auf Selbstbestimmung der Völker, welches in der UNO-Charta nur unauffällig an einer Stelle erwähnt wird (Art. 2 Ziff. 2 UN-Charta). Doch schon auf der Konferenz der blockfreien Staaten 1955 in Bandung wurde es eingefordert und in den Befreiungskämpfen gegen die koloniale Herrschaft in den sechziger und siebziger Jahren gewann es zunehmend an Bedeutung zur Legitimierung des bewaffneten Kampfes. 1960 machte die UN-Generalversammlung in ihrer berühmten Resolution 1514 (XV) „Über die Gewährung der Unabhängigkeit an die kolonialen Länder und Völker“[4] das Recht auf Selbstbestimmung zur zentralen Grundlage der Befreiung von kolonialer Unterdrückung und Fremdherrschaft. Die Resolution wurde mit überwältigender Mehrheit der Staaten bei nur wenigen Stimmenthaltungen aus dem Kreis der alten Kolonialmächte angenommen. Unter Bezug auf diese Resolution wurde das Selbstbestimmungsrecht 1966 in die jeweiligen Artikel 1 der beiden Internationalen Pakte über bürgerliche und politische sowie über wirtschaftliche, soziale, und kulturelle Rechte aufgenommen und somit auch als individuelles Menschenrecht anerkannt. Nachdem das Selbstbestimmungsrecht wenige Jahre später in der sog. Prinzipiendeklaration[5] auch von den alten Kolonialstaaten ohne Widerspruch akzeptiert wurde, gibt es keine Zweifel mehr an der Verbindlichkeit des Selbstbestimmungsrechts als Gewohnheitsrecht.
Die Frage der Gewalt
Damit war allerdings noch nicht geklärt, mit welchen Mitteln, friedlich oder auch mit Gewalt, das Recht ausgeübt werden durfte. Die in jenen Jahren heftigen Befreiungskämpfe insbes. in Afrika und Asien und das sich allmählich verändernde Stimmenverhältnis in der Generalversammlung zugunsten der Staaten des Südens und Ostens zwang die Versammlung schließlich doch, die Realität anzuerkennen und die Gewalt als Mittel des Kampfes um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu akzeptieren. In mehreren Resolutionen wurde den Kämpfern der Kombattantenstatus zuerkannt und der antikoloniale Befreiungskampf mit dem Begriff der (verbotenen) Aggression illegalisiert.[6] Damit ist der Befreiungskampf allerdings nicht von den Regeln des humanitären Völkerrechts befreit. Der absolute Schutz von Zivilisten und zahlreiche Einschränkungen der Kriegsführung gelten auch für sie. Die historische Erfahrung zeigt allerdings, dass in den Befreiungskämpfen immer wieder zum Mittel des Terrors gegriffen wurde – und zwar auf beiden Seiten. Das delegitimiert allerdings noch nicht den Befreiungskampf und nimmt ihm seine völkerrechtliche Rechtfertigung, es sei denn, der Terror nimmt überhand und bestimmt Charakter und Ziel der Kampfhandlungen.
Es ist trotz aller Bemühungen nie gelungen, eine Definition des Terrors vertraglich zu vereinbaren. Das lag vor allem daran, dass jede Partei versuchte, ihren Gegner in die Definition aufzunehmen. So wollten die alten Kolonialmächte die Befreiungsbewegungen und ihren Kampf unter die Definition bringen, die Befreiungsbewegungen wiederum den Staatsterrorismus. Einigkeit scheint jedoch darüber zu bestehen, dass es bei der Unterscheidung nicht auf die Mittel und Methoden der Kriegsführung ankommt, sondern auf die Ziele und Motive, wie es eine Ad-hoc-Kommission der UNO formulierte: „Völker, die darum kämpfen, sich von fremder Unterdrückung und Ausbeutung zu befreien, haben das Recht, alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, auch Gewalt. Es wurde betont, dass der Ausschuss nicht alle Gewaltakte auf internationaler Ebene, unabhängig von ihrem Zweck und ihren Motiven, unter den allgemeinen Begriff des internationalen Terrorismus fassen sollte; Handlungen, die von Bürgern von Staaten begangen werden, die sich im Kriegszustand befinden und die sich dem Angreifer in den besetzten Gebieten widersetzen oder für ihre nationale Befreiung kämpften, können nicht als Akte des internationalen Terrorismus betrachtet werden; Handlungen jedoch, die von einem einzelnen Staat gegen Menschen mit dem Ziel durchgeführt wurden, ihre nationalen Befreiungsbewegungen auszulöschen und den Widerstand gegen die Besatzer zu brechen, sind wahre Manifestationen des internationalen Terrorismus im weitesten Sinne.“[7]
Befreiungsbewegung
Seit dem Angriff Israels auf Gaza im Jahr 2014 (Operation Protective Edge) hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag Untersuchungen über die Kriegsführung sowohl Israels als auch der Hamas aufgenommen. Mit seinen beiden Haftbefehlen vom 21. November 2024 gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Mohammed Deif) wirft er den Beschuldigten vor, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Überfall auf die israelische Zivilbevölkerung seit dem 7. Oktober 2023 begangen zu haben. Die Hamas wird hier juristisch auf die gleiche Stufe wie die israelische Armee (IDF) gestellt. Das hat auf israelischer Seite zwar für Empörung gesorgt, ist jedoch juristisch vollkommen korrekt. Denn unabhängig von ihrer Religion und ihrem Gesellschaftsverständnis ist die Hamas als eine Befreiungsbewegung des palästinensischen Volkes – sie hatte 2006 die gesamtpalästinensischen Wahlen gewonnen – berechtigt, auch Gewalt gegen die Besatzungsmacht zur Befreiung ihres Territoriums anzuwenden. Am 19. Juli 2024 hatte der Internationale Gerichtshof (IGH) in einem Gutachten[8] noch einmal bestätigt, dass Israel das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser verletzt und die Besatzung durch Israel von Anfang (1967) an rechtswidrig ist. Der Widerstand dagegen ist daher mit allen Mitteln gerechtfertigt.
Allerdings wird dieses Recht, wie bereits betont, durch die Vorschriften des humanitären Völkerrechts auf die Gewalt ausschließlich gegen Kombattanten, d. h. israelisches Militär und Militäreinrichtungen, beschränkt. Selbstmordattentate und Angriffe gegen Siedler im Westjordanland sind genauso verboten wie die Angriffe am 7. Oktober 2023 auf Zivilisten in den Kibbuzim oder dem Rave-Festival. Sie sind Kriegsverbrechen, die verfolgt werden müssen. Das stellt jedoch den Ausbruch aus dem Gazastreifen, den Durchbruch durch die Absperrung, die Überwindung der Grenze und den Angriff auf Teile der israelischen Armee und ihre militärischen Einrichtungen nicht unter Terrorverdacht und nimmt ihnen nicht die völkerrechtliche Legitimität.
Dieses Ergebnis mag dem öffentlichen Verständnis vollkommen widersprechen. Wenig hilfreich ist auch, dass gerade der türkische Präsident Erdogan, der die kurdische Bewegung PKK immer noch als Terrororganisation verfolgt, die Hamas als Befreiungsbewegung anerkennt. Dennoch müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die internationale Entwicklung des Völkerrechts hier bereits weiter ist als das in der deutschen Staatsräson gefangene öffentliche Bewusstsein.
Titelbild: zmotions / Shutterstock
[«1] Vgl. Art. 8 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs v. 17. 7. 1998.
[«2] Middle East Eye, middleeasteye.net/news/hamas-2017-document-full
[«3] Helga Baumgarten, Warum der 7. Oktober? Der US-Journalist Jeremy Scahill hat Mitglieder der Palästinenserorganisation Hamas befragt. In: Junge Welt v. 30. Juli 2024, S. 6 jungewelt.de/artikel/480546.nahostkonflikt-warum-der-7-oktober.html.
[«4] UNGV Res. 1514 (XV) v. 14. Dezember 1960, 89+, 0-, 9./., un.org/depts/german/gv-early/ar1514-xv.pdf.
[«5] UNGV Res. 2625 (XXV) v. 24. Oktober 1970, „Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen“, un.org/depts/german/gv-early/ar2625.pdf.
[«6] Z.B. UNGV-Res. 3103 (XXVIII) v. 12. Dezember 1973, digitallibrary.un-or/record/191382?=pdf. Und UNGV-Res. 3314 (XXIX) v. 14. Dezember 1974, un.org/depts/german/gv-early/ar3314_neu.pdf.
[«7] UN.DOC.6/418, S. 7 vom 2. November 1972. documents/un-org/doc/undoc/gen^/n72/204/67pdf/n7220467.pdf2.
[«8] Vgl. IGH-Gutachten vom 19. Juli 2024, icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf.