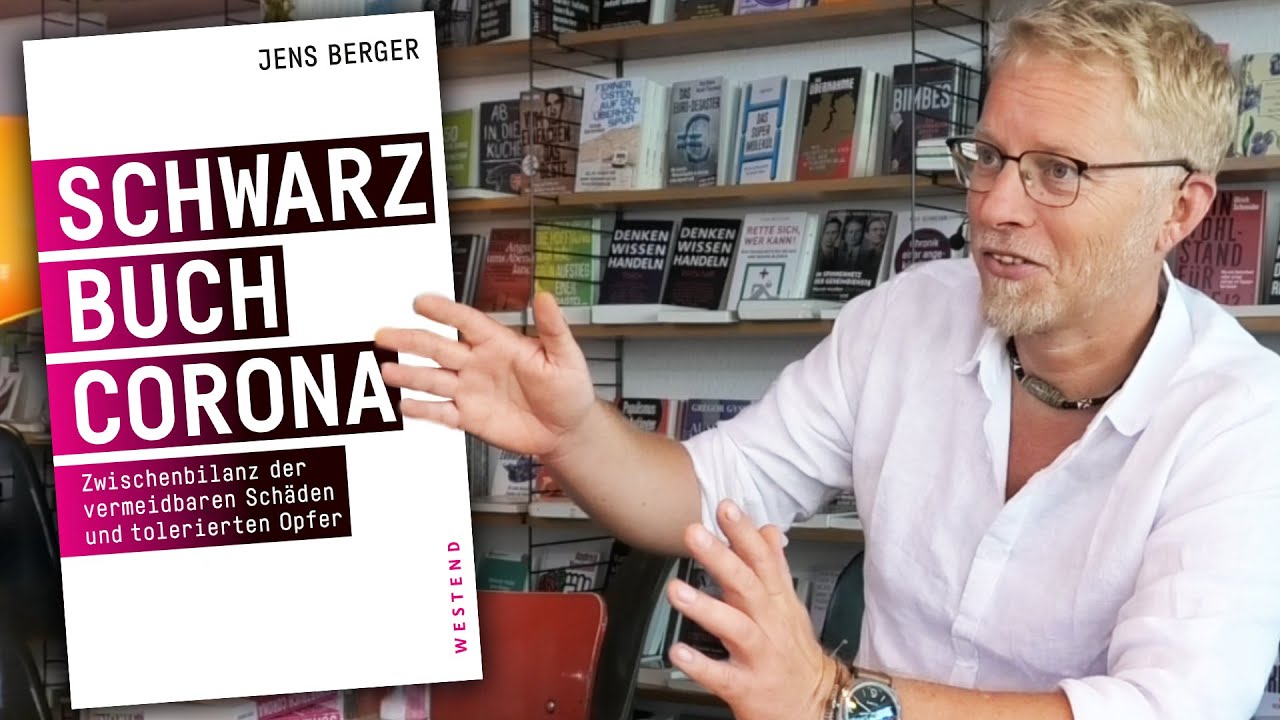Vor unseren Augen zerbricht jenes Zukunfts- und Fortschrittsversprechen, das die westliche Welt über Jahrhunderte zusammenhielt. Da soll aus Kriegsproduktion noch Gewinn erwirtschaftet und die Bevölkerung zur Kriegstüchtigkeit erzogen werden. Statt sich auf die Veränderungen in einer Welt einzustellen, die zunehmend nicht mehr durch die Hegemonie des Westens bestimmt ist, wird ein Kurs der Eskalation gewählt. Wie wir „unsere Feinde selbst schaffen“ und wie wir damit aufhören können, macht Fabian Scheidler mit seinem Buch „Friedenstüchtig“ durchschaubar. Eine Rezension von Irmtraud Gutschke.
Wer auch immer für Olaf Scholz die Rede schrieb, die er als damaliger Kanzler am 27. Februar 2022 vor dem Bundestag hielt, kann sich gratulieren: „Zeitenwende“ wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache nicht nur zum Wort des Jahres 2022 gekürt, sondern ist inzwischen auch zu einem wohlfeilen Begriff geworden für all die beängstigenden Veränderungen, welche die „Zeit“ über uns hereinbrechen ließ. „Putins Krieg“ soll nun alles rechtfertigen, was seitens der Regierung beschlossen wurde und wird. Über unsere Köpfe hinweg – ohne dass wir irgendeine Mitsprache hätten in unseren lebenswichtigen Angelegenheiten. Denn noch braucht es verstärkte Gehirnwäsche, um aus Friedliebenden Kriegswillige zu machen.
„Zeitenwende“, damit wir Unabwendbares einsehen und nicht nach Nutznießern oder gar nach Schuldigen fragen. „Die große Erzählung, dass es, zumindest in der langen Sicht, aufwärts geht, ob durch sozialen Fortschritt oder technische Entwicklung, verliert von Tag zu Tag mehr an Überzeugungskraft“, heißt es im Buch. „Vor unseren Augen zerbricht damit das zentrale Zukunfts- und Fortschrittsversprechen, das die westliche Welt quer durch die politischen Lager über Jahrhundert zusammenhielt.“ [1]
Von den einstürzenden Twin Towers bis zur Gegenwart
Zu Recht spricht Fabian Scheidler von einer „Epoche der Zusammenbrüche“, welche sich indes schon früher abgezeichnet hat. Ein Menetekel sind die einstürzenden Twin Towers gewesen, dann der Finanzcrash, die Eurokrise, der Krieg in Syrien und die Ankunft von Millionen Geflüchteten in Europa, die Corona-Pandemie, deren möglichem Ursprung in einem Labor im Buch ein ganzes Kapitel gilt, der Ukrainekrieg, die Inflation und der Völkermord in Gaza. „Nicht nur ist kein Ende des Krisenmodus abzusehen, der Takt der Katastrophen wird auch immer dichter. Und die größte dieser Krisen, der drohende Klima- und Ökosystemkollaps, hat gerade erst begonnen … ob es die gigantischen Feuersbrünste in Australien, Kalifornien und Südfrankreich sind, die Wirbelstürme in der Karibik und in Südostasien, die Regenfluten im Ahrtal, in Pakistan und Spanien oder die Dürren in Ostafrika und Europa: Angesichts der entfesselten Naturgewalten wirken unsere Löschfahrzeuge, Bewässerungssysteme und Dämme wie Spielzeuge.“ [2]
Schon mit seinem Buch „Das Ende der Megamaschine“ hat der 1968 geborene und in Berlin lebende Historiker und Philosoph komplexe Zusammenhänge durchschaubar gemacht. 2015 im Promedia Verlag erschienen, erlebte dieser Band zehn Auflagen, wurde in sechs Sprachen übersetzt, chinesische und kurdische Ausgaben kommen in Bälde hinzu. Damals schon zeigte sich Fabian Scheidlers Fähigkeit, über den Bannkreis aktueller Bedrückungen hinauszublicken.
Diese Fähigkeit zu einer klaren Zeitdiagnose zeigt sich auch hier. „Von ihrer eigenen strukturellen Krise getrieben, nimmt die globale Ökonomie zunehmend einen ‚kannibalischen Charakter‘ an“, so wird hier die amerikanische Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser zitiert. Um die Profite einiger weniger noch aufrechtzuerhalten, frisst sie öffentliche Güter und Infrastrukturen, die Einkommen und Jobs der Mittelschichten und die Lebensgrundlage kommender Genrationen. [3] Zudem geht die Verwandlung einer Aufstiegs- in eine Abstiegsgesellschaft mit Verlust an Zusammenhalt einher. „Die Fliehkräfte nehmen zu, das Vertrauen in politische Institutionen ist in vielen Ländern geradezu kollabiert. In Deutschland vertrauen laut Umfragen nur noch 21 Prozent der Menschen der Regierung, in Bezug auf politische Parteien sind es ganze 13 Prozent. [4] Vollkommen offen sei es, ob dies zu neuen autoritären oder gar faschistischen Konstellationen oder zu sozialrevolutionären Umbrüchen führen könnten.
Die Hegemonie des Westens – ein sterbender Status Quo
International sind der Aufstieg Chinas und anderer Länder des Globalen Südens ein deutliches Signal, dass eine Epoche zu Ende geht, die von der Vorherrschaft des Westens getragen war. Nicht darin liegt die Gefahr, sondern im Versuch der westlichen Machthaber, die Tragweite notwendiger Veränderungen zu leugnen, um „mit Gewalt die Kontrolle zu behalten und einen sterbenden Status Quo zu verteidigen“. Statt Anstrengungen für den Bau einer neuen Friedensordnung und für einen sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaftsordnung zu unternehmen, wird das Rüstungsbudget aufgestockt. „Die Angst vor einem Krieg, vor einem Zusammenbruch der Wirtschaft, des Gesundheitswesens oder gar der ganzen Zivilisation öffnet die Tür zu Weichenstellungen, deren Tragweite die meisten Menschen gar nicht absehen können.“ [5]
Um diese Überlegungen zuzuspitzen: Mehr als die globalen Herausforderungen selbst, sogar Gewaltakte und Krisen eingeschlossen, führen die politischen Reaktionen darauf zur Verschärfung der Gefahr. Martialisches Reagieren – es könnte sich aus Unfähigkeit, Verblendung erklären lassen. Aber auch aus nüchternem Kalkül: Äußere Bedrohungen – ob durch ein Virus oder einen dämonisierten äußeren Feind – können einem Durchregieren den Weg ebnen, wie es früher kaum möglich war.
In der Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 ist das bereits sichtbar geworden: Von einem Augenblick auf den anderen wurde – gleichsam ohne nachzudenken (oder war es ein Plan?) – der „Krieg gegen den Terror“ ausgerufen, verbal und real. Kriege in Afghanistan und im Irak (da hat sich die BRD unter Gerhard Schröder noch verweigert), verschärfte Sicherheitspolitik in westlichen Ländern, wodurch sich die Sicherheitslage in der Welt kaum verbesserte, sondern eher weiter destabilisierte. [6]
Wie der Gazastreifen zur Mondlandschaft wurde
Martialisches Reagieren, hinter dem sich auch Selbstzweck vermuten lässt. Dem israelischen Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben unter dem Code-Namen „Jericho-Mauer“ bereits ein Jahr vor den Anschlägen des 7. Oktober 2023 detaillierte Pläne vorgelegen. [7] „Ob man der Hamas eine solche Aktion nicht zugetraut hatte, wie die Sicherheitsbehörden später beteuerten, oder ob man es für nützlich hielt, die Angreifer gewähren zu lassen, um einen Anlass für die Inbesitznahme des Gaza-Streifens zu haben, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass Benjamin Netanjahu die Schin-Bet-Einheit auflöste, welche die Funkkanäle der Hamas überwachte, und zwölf Tage vor den Anschlägen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen „eine Karte des ‚neuen Mittleren Ostens‘ präsentierte, die keine Spuren der palästinensischen Territorien mehr zeigte, sondern stattdessen ein ‚Groß-Israel‘, das vom Mittelmeer bis zum Jordan reichte.“ [8]
Im Buch wird kein Zweifel daran gelassen, dass die Geiselnahme durch die Hamas ein Kriegsverbrechen war. Zugleich aber überstieg das folgende Inferno die Dimensionen des Anschlags um viele Größenordnungen. Der Gazastreifen wurde „in eine Mondlandschaft verwandelt, … zwei Millionen Menschen wurden vertrieben und durch die Blockade von Hilfslieferungen vorsätzlich einer Hungersnot ausgesetzt. Ohne die westliche Unterstützung wäre ein solcher Feldzug nicht durchführbar gewesen. Deutschland, als Waffenexporteur auf Platz 5 in der Welt, ist der zweitgrößte Waffenlieferant Israels gewesen. [9]
Als zwanzig der noch lebenden Geiseln am 13. Oktober 2025 freigelassen wurden, ließ sich Trump als „großer Freund Israels“ feiern. „Noch in vielen Generationen wird man sich daran erinnern.” Es werde als das „goldene Zeitalter“ des Nahen Ostens gelten. [10] Netanjahu sprach derweil von einem „Sieg über die Hamas“. Von palästinensischer Seite wird der Waffenstillstand begrüßt, aber auch skeptisch betrachtet. „Wir befürchten, dass Israel den Waffenstillstand sofort nach Abschluss des Gefangenenaustauschs wieder brechen wird“, so wird Omar Assaf, Koordinator des Vorbereitungskomitees der Palestinian Popular Conference (PPC) auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung zitiert. [11]
Der Ukraine-Konflikt: eine Chronik versäumter Gelegenheiten
Im Ukraine-Krieg ist ein Waffenstillstand nicht zustande gekommen. Die ukrainische Seite und ihre westlichen Verbündeten wollten ihn, und Trump versuchte, ihn von Russland zu erpressen. Dabei musste er aus vorangegangenen Gesprächen wissen, dass Russland eine stabile Friedensordnung in Europa erstrebte, in der die sicherheitspolitischen Interessen des Landes Berücksichtigung fänden. All das, was im Entwurf eines Vertrages zwischen Russland und den USA festgehalten war, den die US-Regierung am 17. Dezember 2021 aus Moskau erhielt. Von oben herab wurde das Ansinnen abgeschmettert. Als ob die „Roten Linien“ des Kremls sogar zupass kämen.
Das klug recherchierte Kapitel „Von Gorbatschows Vision eines gemeinsamen europäischen Hauses zum Ukrainekrieg“ zeigt auf überzeugende Weise, worum es eigentlich ging. Gorbatschow habe „Europa und vor allem Deutschland zwei Geschenke von welthistorischer Bedeutung gemacht: die deutsche Wiedervereinigung und die friedliche Beendigung der Blockkonfrontation, von der über Jahrzehnte die Gefahr eines alles vernichtenden Atomkriegs ausgegangen war. Dass seine Geste des guten Willens von der anderen Seite als Kapitulation begriffen wurde, sah er nicht voraus. Die westlichen Regierungen hätten versäumt, „diese Chance zu ergreifen und Gorbatschows Geschenk angemessen zu würdigen“, heißt es im Buch.
Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher mochte an diese Chance geglaubt haben. „Der Westen muss der Einsicht Rechnung tragen, dass der Wandel in Osteuropa und der deutsche Vereinigungsprozess nicht zu einer Beeinträchtigung der sowjetischen Sicherheitsinteressen führen dürfen“, wird er zitiert. Aber das war, als die Sowjetunion noch bestand. [12]
Was die Lektüre dieses Buches auf jeden Fall deutlich macht: Unsere Herzenswünsche nach Verständigung und Frieden einerseits und die Geopolitik mit ihren widerstreitenden machtpolitischen Interessen andererseits bilden zwei Pole, zwischen denen man emotional und rational immer wieder schmerzhaft hin- und hergerissen wird.
Allein schon, wie akribisch genau Fabian Scheidler die Entwicklung der Ost-West-Beziehung zwischen 1990 und 2022 nachzeichnet, macht sein Buch unverzichtbar. Entgegen häufig wiederholter Aussagen, dass es gegenüber Gorbatschow keinerlei Zusagen gegeben habe, die NATO nicht nach Osten auszudehnen, werden hier Versprechungen zitiert, die in dem Maße obsolet wurden, wie sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Hatte François Mitterrand noch im Mai 1990 gegenüber Gorbatschow erklärt, dass er „persönlich begrüßen würde, beide Militärblöcke schrittweise aufzulösen“, änderte sich die Stimmung, als die Auflösung des Warschauer Paktes am 31. März 1991 abzusehen war.
Die NATO-Ost-Erweiterung, gegen die es gerade auch in den USA Einwände gab, wurde vorangetrieben. Dass 1999 Polen, Tschechien und Ungarn in das Bündnis aufgenommen wurden und die NATO das mit Russland verbündete Serbien bombardierte, machte unmissverständlich klar, dass der Westen sich an keinerlei Abmachungen halten würde.
An Putins Reden vor dem Deutschen Bundestag 2001 und vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 wird erinnert, ebenso wie an die Warnung 2008 von William Burns, damals US-Botschafter in Moskau, dass der Versuch, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, die „Russen“ dazu bringen würde, „sich in die Krim und die Ost-Ukraine einzumischen“. [13] Der damalige Verteidigungsminister und frühere CIA-Direktor Robert Gates schloss sich dem an.
Auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest hatte die US-Regierung bekanntlich versucht, eine Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die Allianz durchzusetzen, scheiterte aber an den Einwänden Deutschlands und Frankreichs. Dass Georgien zwischen 2002 und 2008 mit US-Hilfe massiv aufgerüstet wurde – „das Militärbudget stieg von 18 auf 900 Millionen Dollar“ – ließ den lange schwelenden Konflikt mit Russland in einen offenen Krieg umschlagen. [14]
Akribisch genau und aufschlussreich ist dieses Kapitel – bis hin zum geleakten Telefonat zwischen Victoria Nuland, damals US-Chefdiplomatin für die EU, und Geoffrey Pyatt, US-Botschafter in Kiew, das zur Implementierung einer Marionetten-Regierung führte. Dargestellt wird, wie es zur Angliederung der Krim, zur Abspaltung der „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk sowie zu einem Krieg ukrainischer Regierungstruppen gegen die Ostukraine kam. Selenskyj, ab Mai 2019 Präsident der Ukraine, hatte im Wahlkampf versprochen, Minsk II endlich umzusetzen und dem Donbass durch Verhandlungen mit Russland Frieden zu bringen. „Mit Morddrohungen von Führern der Rechtsextremen konfrontiert“, habe er diese Bemühungen aufgegeben. [15]
Bekräftigung des NATO-Beschlusses zur Mitgliedschaft der Ukraine im Juni 2021, gemeinsame Manöver im Schwarzen Meer, Abkommen zur strategischen militärischen Partnerschaft mit den USA, Warnung aus Moskau vor der Stationierung von Raketensystemen, die Russland treffen können und schließlich besagter Vertragsentwurf vom 17. Dezember 2021 – an vielen Abzweigungen, die Entspannung hätten bringen können, ist der Westen „stur vorbeimarschiert, trotz lautstark warnender Stimmen“. [16] „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“, hatte die deutsche Außenministerin vor dem Europarat gesagt. Die derzeitige Bundesregierung ist dem gefolgt. [17]
Wege zu „Gemeinsamer Sicherheit“
„Friedenstüchtig“ – im Titel des Buches steckt ein Appell. Der Untertitel „Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen“ zeigt einen Weg auf, bei dem man an die Bergpredigt Jesu denkt: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“ Das heißt, auf die politische Gegenwart bezogen, zuerst einmal Ehrlichkeit. Sich die eigenen machtpolitischen Interessen einzugestehen, wäre der erste Schritt, der zweite aber wäre, auch der anderen Seite Interessen zuzugestehen, statt sie zu verteufeln.
Gerade hat der neue BND-Präsident Martin Jäger im Bundestag vor der Gefahr eines militärischen Konfliktes mit Russland gewarnt. Russlands Handeln sei „darauf angelegt, die NATO zu unterminieren, europäische Demokratien zu destabilisieren, unsere Gesellschaften zu spalten und einzuschüchtern“, sagte er und forderte mehr Befugnisse für seinen Dienst. Denn in Moskau rechne man sich „realistische Chancen aus, die eigene Einflusszone nach Westen auszuweiten und das wirtschaftlich vielfach überlegene Europa in die Abhängigkeit von Russland zu bringen.” [18]
Ein klares Feindbild. Gesinnung oder Auftrag. Als Relikt des Kalten Krieges, gar als revanchistischer Nachhall von 1945, als die deutsche Wehrmacht vor der Sowjetarmee kapitulieren musste. Fabian Scheidler hat recht, dagegen auf Friedenspolitiker wie Willy Brandt, Egon Bahr und Olof Palme zu verweisen. „Wenn der Westen nach 1990 den Weg der Entspannung konsequent fortgesetzt hätte und Russland in ein System gemeinsamer Sicherheit auf der Grundlage der KSZE integriert hätte, statt die Expansion eines keineswegs nur defensiven Militärbündnisses voranzutreiben, würden wir heute in einer vollkommen anderen und mit großer Wahrscheinlichkeit friedlicheren Welt leben.“ [19]
Die Frage ist freilich, wie sich das heute durchzusetzen ließe in diesem von widerstreitenden Macht- und Profitinteressen beherrschten Weltsystem, in dem der Westen seine Dominanz auf Teufel komm raus verteidigen will. Da stehen die Vereinten Nationen an einem Scheideweg, entweder in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen oder sich unter veränderten Bedingungen zu reformieren. Wobei eine große Mehrheit der Staaten im Globalen Süden in ihrem Streben nach einer multipolaren Weltordnung die UN als unverzichtbar betrachten. Auch China, das wirtschaftlich in absehbarer Zeit die führende Weltmacht sein wird, betont die führende Rolle der UN. Vielleicht ist es tatsächlich so: „Wenn es um die Lösung von Konflikten geht, wenden sich die Augen zunehmend Richtung Asien.“ [20]
Was „friedenstüchtig“ bedeuten würde
Sich der Konflikte bewusst, diese zum Nutzen des eigenen Volkes zu entschärfen – wäre das Wesen friedenstüchtiger Politik. Wir aber werden von Leuten regiert, welche allein schon mental-emotional dazu nicht in der Lage sind. Wenn es tatsächlich eine Bedrohungslage gäbe, wäre es doch normal, wenigstens mal zum Telefonhörer zu greifen. Aber da scheint eine Angststarre vorzuherrschen, die sich mit aggressivem Gehabe tarnt.
In Krisenzeiten ist Krieg tatsächlich – leider – ein Geschäftsmodell. Aus einer zunehmend prekären Lage versucht sich die politische Klasse zu retten. Durch profitable Aufrüstung und Demokratieabbau, um die Zügel der Macht nicht aus den Händen zu verlieren. Denn wie James Madison, einer der Väter der US-Verfassung und 4. Präsident der USA, vor über 200 Jahren sagte: „Die vorrangige Funktion einer Regierung ist es, die Minderheit der Reichen vor der Mehrheit der Armen zu schützen!“
Im Buch sind viele Fakten zusammengetragen, wie gerade in den USA Protestaktionen unterdrückt wurden. Um Protest klein zu halten oder gar nicht erst entstehen lassen, gibt es inzwischen vielerlei Mittel der psychologischen Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung. Die „Neue Gesellschaft für Psychologie“ hat sich im April 2025 auf einem Kongress damit befasst. [21] Angefangen damit, dass Jüngeren gar nicht mehr bewusst ist, was Krieg bedeutet, wird eine Hysterie geschürt, die Panikstimmungen auch immer wieder in Erschöpfung und Lethargie umschlagen lässt.
Was für Menschenmassen bewegten sich unlängst beim „Festival of Lights“ durch Berlin! Glückssüchtig, sicher nicht kriegsbereit, aber viele auch nicht fähig, kämpferisch für Frieden einzutreten. „Warum schweigen die Lämmer?“ – in seiner scharfsinnigen Analyse zur Meinungsmanipulation im Neoliberalismus ist Rainer Mausfeld dieser Frage nachgegangen. [22]
Dass Friedensbewegungen historisch besonders erfolgreich waren, wenn sie sich mit anderen Bewegungen verbanden, stellt Fabian Scheidler fest. Nach dem Muster etwa der britischen Bewegung „Wellfare, not Warfare“ gegen die Aufrüstung und für eine Verteidigung der öffentlichen Wohlfahrt einschließlich des Gesundheits- und Schulsystems. „Solche Ansätze haben erhebliches Potenzial, immerhin liegt die Verteidigung des Sozialstaats im Interesse der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung.“ [23] Aber welche Machtmittel hat eine in sich vereinzelte Bevölkerung noch? Andererseits, können wir denn hoffen, dass sich ohne unser Zutun etwas ändert? Gerade wenn man die Kriegstreiberei in ihren Ursachen durchschaut, sieht man den riesigen Machtapparat, der dahintersteht. Das kann mutlos machen.
Immer wieder flammt die Hoffnung auf, der Ukraine-Krieg könnte zu Ende gehen, wenn Trump und Putin sich verständigen. Gerade war von einem möglichen Treffen in Budapest die Rede. Wenn es da wirklich zu einem erfolgversprechenden Gespräch käme – der Wind kann sich jederzeit drehen – stehen noch die Interessen derjenigen im Raum, die den Krieg gegen Russland bis zum letzten Ukrainer zu führen gedenken. Noch mehr Tote, noch mehr Zerstörungen. Irgendwann wird dann die Entscheidung auf dem Schlachtfeld fallen, doch bis dahin wird Europa wirtschaftlich bluten.
Und wie sollte von russischer Seite die deutsche Feindseligkeit vergessen werden? Mühsam gewachsen war das Vertrauen zu unserem Land, das – vertragsbrüchig gegenüber der Sowjetunion – den mörderischen Zweiten Weltkrieg vom Zaun brach. Es dürfte nicht schwierig sein, eine Provokation zu erfinden, die zu einem dritten führt. Dann wären die USA auf lange Sicht die Sorge los, dass durch ein Zusammenrücken von Deutschland und Russland ein großes konkurrierendes Machtzentrum in Europa entstehen würde. Vorher hätte das Waffengeschäft geblüht. Und viele von uns lägen unter verbrannter Erde.
Was friedenstüchtig für uns bedeuten würde? Sich zunächst einmal, sich selbst nicht kriegswillig und -fähig machen zu lassen. Zur Lage im Land und in der Welt gibt es divergierende Meinungen. Mindestens seit Corona ist die Stimmung auf Feindschaft getrimmt. Das macht sich Kriegspolitik zunutze. Entgegen dieser Gefahr gilt es, die Kräfte bündeln. Das Friedensgebot im Grundgesetz könnte ein gemeinsamer Nenner sein.
Titelbild: kryzhov / Shutterstock
[«1] Fabian Scheidler: Friedenstüchtig. Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen. Promedia Verlag 2025, S.10
[«2] ebenda, S. 10 f
[«3] ebenda, S. 11
[«4] stern.de/gesellschaft/umfrage–deutsche-haben-wenig-vertrauen-in-die-politik–34434518.html
[«5] Scheidler, S.12
[«6] lpb-bw.de/langfristige-entwicklungen-nach-9/11
[«7] nytimes.com/2023/11/30/world/middleeast/israel-hamas-attack-intelligence.html
[«8] scheidler,27f
[«9] ebenda, S. 31
[«10] zdfheute.de/politik/ausland/liveblog-nahost-israel-gaza-100.html
[«11] rosalux.de/news/id/53890/waffenruhe-in-gaza-stimmen-aus-palaestina.html
[«12] Hans-Dieter Heumann: Hans-Dietrich Genscher. Die Biografie. Schönigh Verlag, 2012, S. 280
[«13] Scheidler, S. 129
[«14] welt.de/politik/article2420257/Russland-will-UN-Waffenembargo-gegen-Georgien.html
[«15] Scheidler, S. 137
[«16] ebenda, S. 139
[«17] zeit.de/politik/ausland/2023-01/annalena-baerbock-russland-krieg-aussage
[«18] zeit.de/politik/deutschland/2025-10/bnd-praesident-reale-gefahr-russland-krieg-andgriff-militaer
[«19] Scheidler, S. 157
[«20] ebenda, S. 166
[«21] Brudder/Bruder-Bezzel/Lemke/Stahmer-Weinndy (Hg.): Militarisierung der Gesellschaft. Von der Glückssüchtigkeit zur Kriegsbereitschaft. Promedia, 2025.
[«22] Rainer Mausfeld: Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören. Westend, 2018/19.
[«23] Scheidler, S.169