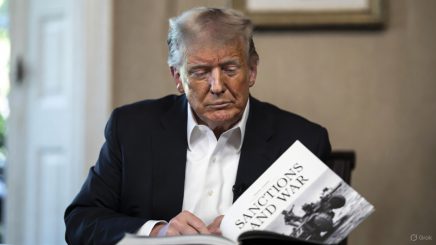In den letzten Wochen hat Washington seine Drohungen und Feindseligkeiten gegenüber Venezuela eskaliert und US-Präsident Donald Trump bestätigte offen, dass er die CIA zu verdeckten Aktionen gegen das Land ermächtigt hat. Diese Maßnahmen sind besorgniserregend und stellen eine ernsthafte Verschärfung der Kriegstreiberei gegen das karibische Land dar. Sie bestätigen auch, was viele seit Jahren sagen: Die USA sind stark an den Geschehnissen in Venezuela beteiligt und scheuen sich nicht, alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Von Manolo De los Santos.
„Kann irgendjemand wirklich glauben, dass die CIA nicht schon seit 60 Jahren in Venezuela operiert?“, fragte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, nachdem Trump die Genehmigung für CIA-Aktivitäten in seinem Land bekannt gegeben hatte.
Die Antwort, betrachtet man die historischen Fakten der letzten zwei Jahrhunderte, bestätigt ein Muster kontinuierlicher Einmischung mit dem Ziel, die Vorherrschaft der USA über die gesamte Hemisphäre zu behaupten.
Die eskalierenden Kriegsdrohungen der Trump-Regierung gegen Caracas stellen keine neue Politik dar, sondern den Höhepunkt eines langjährigen Projekts zum Regime Change, das große und beunruhigende Ähnlichkeiten mit der Kriegstreiberei der Bush-Regierung gegen den Irak aufweist.
Washington hat Lateinamerika und die Karibik stets durch die Brille der Monroe-Doktrin betrachtet und sich die Region einseitig für die geopolitische Vorherrschaft der USA vorbehalten. Die letzten 200 Jahre zeigen ein Muster wiederholter, aggressiver Interventionen.
Unter den offenkundigsten Beispielen der jüngeren Vergangenheit, bei denen sich das Engagement der USA auf politische Unterstützung, Geheimdienstoperationen und direkte militärische Interventionen erstreckte, sind der Putsch gegen Jacobo Arbenz in Guatemala 1954, die Invasion der Dominikanischen Republik 1965, die die Rückkehr einer progressiven Regierung unter Juan Bosch vereitelte, der Putsch von 1973, der das sozialistische Projekt von Salvador Allende in Chile zunichtemachte, das Komplott von 1983 zumm Sturz der Regierung von Maurice Bishop und die Invasion von Grenada sowie der Sturz des haitianischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide in den Jahren 1991 und 2004. Der Putsch von 2009 in Honduras gegen die Regierung von Mel Zelaya setzte diese Tradition fort.
Venezuela ist indes zum definitiven Ziel geworden und sah sich in den letzten 25 Jahren mehr von den USA unterstützten Versuchen eines Regime Change ausgesetzt als jedes andere lateinamerikanische Land. Die Besessenheit, die Kontrolle über das Land zurückzugewinnen, begann kurz nach der Wahl von Hugo Chávez im Jahr 1998. Sein Sieg signalisierte eine radikale Abkehr von der von den USA geförderten neoliberalen Politik und den Beginn einer Phase großer Veränderungen, von der Armutsbekämpfung bis zur regionalen Integration, angeführt von einer Welle linker Regierungen in Lateinamerika.
Washington unterstützte aktiv zahlreiche Versuche, Chávez zu stürzen, insbesondere einen Militärputsch im Jahr 2002, der durch einen Massenaufstand vereitelt wurde, und die lähmende Ölblockade von 2002 bis 2003, die darauf abzielte, die wichtigste Einnahmequelle des Landes lahmzulegen.
Sowohl unter George W. Bush als auch unter Barack Obama wurden Millionen von Dollar bereitgestellt, um rechtsgerichtete Gruppen in Venezuela, denen es oft an einer sozialen Basis mangelte, durch Taktiken, die von Attentatsplänen bis hin zu terroristischen Aktionen reichten, in eine direkte Konfrontation mit der venezolanischen Regierung zu treiben.
Diese Finanzmittel dienten der Unterstützung von Gruppen und Führern, die sich zwar als demokratische Opposition oder Nichtregierungsorganisationen ausgaben, sich jedoch stets für die gewaltsame Absetzung der demokratisch gewählten Regierung des Landes einsetzten. Eine bekannte Empfängerin von US-Geldern ist María Corina Machado, die rechtsradikale Politikerin, die kürzlich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde und die ihre politische Karriere auf jahrzehntelangem Eintreten für ausländische Interventionen der USA und Israels aufgebaut hat.
Das Muster der Unterstützung für einen Regime Change setzte sich nach dem verdächtigen Tod von Chávez im Jahr 2013 fort, was viele zu Spekulationen über eine Verschwörung der CIA veranlasste. Nach der Wahl von Nicolás Maduro unterstützte die Obama-Regierung 2014 eine Welle gewalttätiger Proteste, sogenannte Guarimbas, die durch rassistische Lynchmorde an schwarzen Anhängern der Regierung durch rechte Mobs gekennzeichnet waren. Maduro war 2017 erneut mit einer anhaltenden Phase gewalttätiger Proteste konfrontiert, die von den USA unterstützt wurden. Der 21-jährige Afro-Venezolaner Orlando Figuera wurde im Mai 2017 in Caracas von oppositionellen Aktivisten angegriffen und lebendig verbrannt.
Verschärfte wirtschaftliche Belagerung
Im Jahr 2015 eskalierte Präsident Obama den rhetorischen und wirtschaftlichen Druck, indem er Venezuela zu einer „ungewöhnlichen und außerordentlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA” erklärte. Diese Anschuldigung wurde weithin als faktisch unbegründet angesehen und zunächst sogar von einigen venezolanischen Oppositionsführern zurückgewiesen. Trotzdem lieferte die Erklärung den rechtlichen Vorwand für die Verhängung von Sanktionen, die den Zusammenbruch der Ölindustrie einleiteten und die venezolanische Wirtschaft zugrunde richteten.
Im ersten Jahr von Trumps erster Amtszeit verhängten die USA noch härtere Sanktionen, die direkt auf den venezolanischen Ölsektor abzielten. Vor den Sanktionen von 2017 betrug der durchschnittliche monatliche Rückgang der Ölproduktion etwa ein Prozent. Nach der Verordnung vom August 2017, mit der Venezuela der Zugang zu den US-Finanzmärkten versperrt wurde, stieg die Rückgangsrate drastisch um mehr als das Dreifache.
Die Sanktionen vom August 2019 schufen den „rechtlichen” Rahmen für die Beschlagnahmung von venezolanischem Auslandsvermögen in Milliardenhöhe und richteten sich speziell gegen die staatliche Ölgesellschaft PDVSA. Das Verbot von Exporten in den US-Markt, der zuvor mehr als ein Drittel des venezolanischen Öls abnahm, war ein katastrophaler Schlag.
Das Washington Office on Latin America (WOLA) dokumentierte, dass diese Sanktionen dazu führten, dass der venezolanische Staat zwischen 17 und 31 Milliarden US-Dollar an potenziellen Öleinnahmen verlor. Dieser Verlust an Devisen schränkte die Möglichkeiten des Staates, Lebensmittel, Medikamente und lebenswichtige Güter zu importieren, direkt ein, was zu einem Anstieg der Sterblichkeitsrate und einer regelrechten humanitären Krise führte. Die Verschärfung der US-Sanktionen, insbesondere seit 2017, trug dazu bei, dass Venezuela den größten Wirtschaftsrückgang in der lateinamerikanischen Geschichte erlebte, mit einem geschätzten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 74,3 Prozent zwischen 2014 und 2021.
Das Irak-Szenario, aktualisiert: Sanktionen als Wirtschaftskrieg
Die erste Trump-Regierung verfolgte eine Politik des „maximalen Drucks”, um Maduro zu stürzen, und formalisierte das Ziel eines Regime Change mit beispielloser Aggressivität. Zusätzlich zu den strafenden Ölsanktionen führte dies auch zu der absurden Unterstützung der Selbsternennung von Juan Guaidó zum Präsidenten im Januar 2019.
Diese Politik führte schließlich auch zur Entsendung von US-Kriegsschiffen und zur Einstufung der Maduro-Regierung als „narco-terroristische“ Gruppierung, was an die Vorwände für die Invasion des Irak im Jahr 2003 erinnert. Das gipfelte in der nachfolgenden Finanzierung der „Operation Gideon“, einer missglückten maritimen Invasion durch von den USA unterstützte Söldner im Mai 2020, die als „Ferkelbucht“[1] in die Geschichte eingegangen ist[2].
Die rhetorischen Parallelen zwischen den beiden Kampagnen sind frappierend. Im Jahr 2003 rechtfertigte die Bush-Regierung den Krieg mit erfundenen Behauptungen über Saddam Husseins Besitz von „Massenvernichtungswaffen“ und angebliche Verbindungen zum Terrorismus. In ähnlicher Weise versucht die Trump-Regierung, militärische und verdeckte Aktionen in Venezuela zu rechtfertigen, indem sie sich auf das Narrativ vom „Drogen-Terrorismus“ beruft.
In beiden Fällen handelt es sich um Versuche, einen politischen Konflikt in eine Sicherheitsbedrohung umzuwandeln, die präventiv eine militärische Reaktion erforderte.
Die gravierendste Ähnlichkeit besteht jedoch in der Strategie der gegen beide Nationen angewandten wirtschaftlichen Strangulierung.
Von 1990 bis zur Invasion 2003 wurden umfassende multilaterale Sanktionen gegen den Irak verhängt, die die Zivilbevölkerung schwer trafen, aber nicht zur Absetzung Saddam Husseins führten. Diese Maßnahmen führten zu starken Einschränkungen der irakischen Ölexporte und einer strengen Kontrolle der Warenimporte. Die Folge war eine humanitäre Katastrophe. Studien schätzen, dass die Sanktionen zum Tod von Hunderttausenden Kindern unter fünf Jahren durch Unterernährung und Mangel an sauberem Wasser und Medikamenten beigetragen haben.
Der frühere stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen, Denis Halliday, der aus Protest zurücktrat, bezeichnete die Sanktionen als „völkermörderisch“.
Die Brutalität dieser Politik wurde von der damaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Madeleine Albright, auf infame Weise zusammengefasst, als sie auf die Frage, ob der Tod einer halben Million irakischer Kinder „es wert” gewesen sei, antwortete: „Wir denken, es ist den Preis wert.”
Die Sanktionen gegen Venezuela, insbesondere die 2019 gegen die Ölindustrie verhängten, wiederholten diese Strategie der kollektiven Bestrafung, zu Beginn sogar noch mit größerer Härte. Im Gegensatz zum Irak, der schließlich durch das von der UNO verwaltete Öl-für-Lebensmittel-Programm etwas Entlastung erhielt (trotz der Bemühungen der USA und Großbritanniens, lebenswichtige humanitäre Lieferungen mit der Begründung einer möglichen „doppelten Verwendung“ zu blockieren), wurde die venezolanische Regierung sofort von ihrer wichtigsten Devisenquelle abgeschnitten.
Das Center for Economic and Policy Research (CEPR) stellte fest, dass die umfassenden Sanktionen von 2019 zu einem fast vollständigen Handelsembargo führten, das möglicherweise „drakonischer“ war als die Sanktionen gegen den Irak vor dem Krieg – unter Hinweis darauf, dass es keinen vergleichbaren humanitären Mechanismus gab, um den Verlust von Milliarden an Öleinnahmen abzumildern.
Hegemonie und die ideologische Herausforderung
Das Interesse der USA an Venezuela geht über die bloße Kontrolle der weltweit größten Ölreserven hinaus. Das primäre Ziel ist ideologischer und politischer Natur: der Sturz einer unabhängigen Regierung, die sowohl eine Stütze für andere progressive Regierungen als auch ein Stolperstein für US-Pläne ist, ultrarechte Regierungen in der Region zu installieren. Die venezolanische Regierung stellt einen Knotenpunkt des Widerstands dar, und ihr erfolgreicher Sturz würde die Dominanz der US-Außenpolitik in der Region wieder geltend machen und eine klare Botschaft an andere Nationen senden, die einen unabhängigen politischen und wirtschaftlichen Kurs einschlagen wollen.
Bei den Interventionsdrohungen geht es also nicht nur um Wirtschaft, sondern auch um die Verteidigung der ideologischen Integrität der Monroe-Doktrin im 21. Jahrhundert.
Die aktuelle Eskalation der Feindseligkeiten gegenüber Venezuela unter Trump stellt eine akute und gefährliche Phase dar, die durch außergerichtliche Angriffe in der Karibik und explizite Drohungen mit Landangriffen gekennzeichnet ist. Seit Anfang September wurden bei diesen Angriffen zahlreiche Menschen getötet. Einige der Opfer wurden als Staatsbürger Kolumbiens und Trinidad und Tobagos identifiziert. Die US-Regierung hat die Opfer ohne konkrete Beweise als „Drogenterroristen“ bezeichnet, während ihre Familien versichern, dass es sich bei den Getöteten um Fischer handelte.
Die Kampagne gegen Venezuela ist im Wesentlichen eine Fortsetzung der seit zwei Jahrhunderten andauernden Bemühungen, die imperiale Kontrolle über die Region aufrechtzuerhalten. Trumps wahnwitziger, unerbittlicher Drang, Nicolás Maduro zu stürzen, als Teil eines historischen Zwangs, seine Dominanz nicht nur durch Sanktionen und die Unterstützung innerer Unruhen, sondern nun auch durch außergerichtliche Tötungen auf See und Drohungen mit Landoperationen zu behaupten, hat die Region an die Schwelle eines massiven Konflikts gebracht. Ein solcher Krieg wäre nicht nur eine Katastrophe, die einen enormen Truppeneinsatz erfordern würde, sondern würde mit ziemlicher Sicherheit ganz Lateinamerika destabilisieren und weit über die Grenzen Venezuelas hinausgreifen.
Allerdings hat sich eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gegen den Einsatz militärischer Gewalt zur Invasion Venezuelas ausgesprochen, und es wurde eine überparteiliche Resolution von den Senatoren Adam Schiff (Kalifornien) und Rand Paul (Kentucky) eingebracht, um Trump davon abzuhalten, Gewalt gegen Venezuela anzuwenden. Die endgültige Entscheidung über dieses gefährliche Abenteuer liegt möglicherweise noch bei der amerikanischen Öffentlichkeit, die Transparenz und ein sofortiges Ende des Marsches in einen weiteren katastrophalen Krieg einfordern muss.
Der Beitrag erschien im Original bei The Left Chapter, Übersetzung aus dem Englischen von Marta Andujo.
Über den Autor: Manolo De Los Santos aus den USA ist Vorstandsmitglied des People’s Forum und Mitarbeiter des Tricontinental: Institute for Social Research. Seine Artikel erscheinen regelmäßig in Monthly Review, Peoples Dispatch, CounterPunch, La Jornada und anderen progressiven Medien.
Titelbild: Ein mit KI (grok) erstelltes Symbolbild
US-Regime-Change Pläne für Venezuela: Fünf Szenarien
Operation Regime Change: US-Präsident Trump genehmigt verdeckte Einsätze der CIA in Venezuela
[«1] „Invasion in der Ferkelbucht” (bay of piglets) ist die spöttische Bezeichnung für eine gescheiterte Putschoperation in Venezuela im Mai 2020. Sie wurde von einem ehemaligen Green Beret geleitet und sah die Gefangennahme Maduros und weiterer Regierungsmitglieder vor, endete aber in einem Desaster für die beteiligten Söldner. Zu den mutmaßlichen Verwicklungen der US-Regierung siehe The Grayzone: White House insiders knew of 2020 Venezuela coup in advance, files show.
[«2] Die gescheiterte Invasion in der „Schweinebucht“ (bay of pigs) war ein von den USA 1961 organisierter militärischer Angriff kubanischer Exilanten zum Sturz der Revolutionsregierung unter Fidel Castro. Bei Wikipedia heißt es dazu: „Der von der CIA ausgearbeitete Plan ging von Geheimdienstberichten aus, die von interessierter Seite, den Revolutionsgegnern auf Kuba, kamen, die alle ihre Hoffnungen auf ein militärisches Eingreifen der USA richteten und deshalb wider besseres Wissen von einer breiten antirevolutionären Stimmung auf Kuba berichteten.“