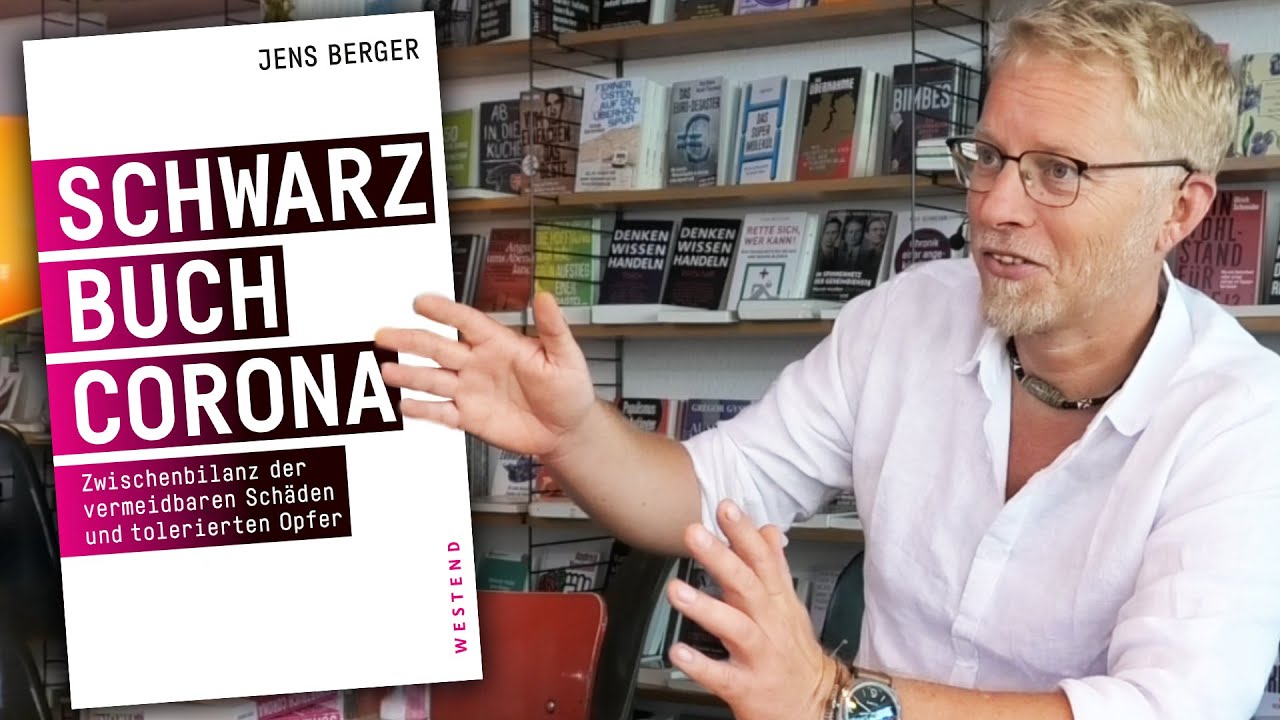Vom 31. August bis zum 1. September trafen sich die Staatschefs der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in China zum 25. Gipfel der Organisation – ein bis dahin, ähnlich wie die BRICSplus-Treffen, wenig im Westen beachtetes Ereignis, zumindest offiziell. Dieses Mal jedoch war es anders, und zwar nicht nur, weil der chinesische Präsident Xi als Gastgeber weitereichende Ziele und Projekte verkündete, sondern auch, weil er Staatschefs empfing (Präsident Putin, Nordkoreas Kim Jong-un, den iranischen Präsidenten Pesechkian, den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko) und mit diesen in tiefer Vertrautheit kommunizierte, die der Westen als die Verkörperung des Bösen betrachtet: Damit wäre das Bild vom SCO-Gipfel als Hort der „Autokraten“ und „Diktatoren“ ja abgerundet gewesen – wäre da nicht der Konjunktiv „wäre“. Von Alexander Neu.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Die Realität der internationalen Politik ist in den letzten zehn Jahren komplexer geworden. Die eingeübten klassischen Dichotomisierungen wie zu Zeiten der Ost-West-Konfrontation – dort die „kommunistischen Regime“, hier die „Demokratien“ – oder nach Beendigung des Kalten Krieges – dort die „Autokraten“/„Diktatoren“, hier die „Demokratien“ – funktionieren immer weniger, wenn sie überhaupt als Raster zur Erfassung politischer Realitäten jemals funktioniert haben sollten. Denn am Gipfeltreffen nahm auch der indische Ministerpräsident Modi teil, der Vertreter der – gemessen an der Einwohnerzahl – größten Demokratie der Welt, und zwar nicht als Gast, sondern als Mitglied der SCO seit 2017. Besonders das Verhalten des indischen Ministerpräsidenten stieß im Westen auf Unmut. Er ließ sich mit Alexander Lukaschenko in vertrauter Atmosphäre ablichten. Mehr noch hat ein Bild für besondere Aufmerksamkeit gesorgt: Modi hält die Hand Putins und spricht entspannt mit Xi.
Eigentlich befinden sich Indien und China ungeachtet ihrer gemeinsamen Mitgliedschaften in der SCO sowie in der BRICSplus in einem seit Jahrzehnten bestehenden Dauerkonflikt. Der Abschuss indischer Kampfflugzeuge durch das pakistanische Militär mit chinesischen Raketen im Frühjahr war das jüngste Beispiel dieses angespannten Verhältnisses. Das Bild der drei genannten Staatschefs in trauter Harmonie kontrastiert jedoch massiv mit dem eigentlichen Spannungsverhältnis zwischen Indien und China. Dank des US-Präsidenten Donald Trump, der den Knüppel der Handels- und Sanktionspolitik auch gegen Indien schwingt, was für Indien eine Demütigung darstellt, scheinen sich die Verhältnisse neu zu ordnen, und zwar nach ganz unideologischen und pragmatischen Gesichtspunkten. Politischer Realismus statt ideologischer Scheuklappen, tradierter Feindseligkeiten und Blockdenkens dominiert offensichtlich das Denken und Handeln der Staaten des Nicht-Westens. Hat die Siegerpose des Westens nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und damit einhergehend die kurzsichtige westliche Hybris, insbesondere symbolisiert durch den NATO-Angriffskrieg auf Serbien und die NATO-Osterweiterung entgegen den Versprechungen und Abkommen („Charta von Paris“), Russland immer weiter in die Arme Chinas getrieben, so scheint nun auch das eigentlich nach allen Seiten offene und moderate Indien sich zunehmend China anzunähern.
Ein Blick auf die Weltkarte legt nahe, dass es sinnvoller ist, im regionalen Raum Stabilitäten und Partnerschaften zu pflegen denn interregionale Kooperationen – hier mit den USA – zu priorisieren, die nicht auf Augenhöhe stattfinden und auch auf Kosten der regionalen Stabilität gehen können.
Allein die Anwesenheit Indiens machte es den westlichen Beobachtern aus Politik und Mainstreammedien schwer, das SCO-Gipfeltreffen als reinen Hort des Üblen zu brandmarken. Mit einem gehörigen Maß an Ohnmacht muss der Westen zuschauen, wie sich neue Akteure und neue Kooperationsverhältnisse in der Weltpolitik etablieren sowie formieren und dem Westen der Zutritt in diese Formate verwehrt wird. Eine für das westliche Selbstverständnis gewöhnungsbedürftige Entwicklung, dass gestaltende Weltpolitik nicht mehr nur vom Westen (USA, NATO und G-7) ausgeht, sondern sogar ohne den Westen stattfindet – insbesondere dann, wenn es um regionale und transkontinentale Herausforderungen jenseits des transatlantischen Raumes geht. Dass Weltregionen und Kontinente ohne raumfremde Interventionen selbst über ihre Schicksale entscheiden wollen, wird in westlichen Redaktionstuben und Regierungen mit Unverständnis, ja als Ungeheuerlichkeit betrachtet, ja geradezu als Angriff auf die westliche Globalhegemonie verstanden.
Bekannte Aussagen wie „unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt“ – oder nachdem das mit dem Freiheitskampf am Hindukusch dann doch schiefgelaufen ist, wird die Freiheit nun halt in der Ukraine zu verteidigen versucht – oder die „regelbasierte internationale Ordnung“: All dies steht für einen exklusiven Gestaltungsanspruch. Ähnlich lautende Aussagen, die nationalen Sicherheitsinteressen der USA würden im Balkan, am Persischen Golf, in Lateinamerika, auf Grönland oder sonst wo auf dem Globus und vermutlich auch auf dem Mond gefährdet, belegen geradezu dieses expansionistische, ja imperialistische Selbstverständnis: Die Welt gehört uns, und zwar für immer. Ganz so, als ob diese Dominanz gegenüber dem Rest der Welt ein Naturgesetz, ja geradezu ein Ausdruck höchster menschlicher Rationalität sei. Es kann einfach nicht anders sein, wir führen die Welt, basta! Der globale Führungsanspruch der USA wird durch die mit Abstand höchsten Militärausgaben der Welt materialisiert. Die „Tagesschau“ und die BILD-Zeitung bringen dieses Verständnis des Großmachtnarzissmus auf den Punkt:
„Der Zusammenschluss (…) zu Sicherheits- und Wirtschaftsthemen soll eine Art Gegengewicht zu Bündnissen demokratisch regierter Staaten sein.“
Das Leitmedium für bekannterweise besonders hohe journalistische Qualitätsstandards, die BILD-Zeitung, titelte:
„Diktatorentreffen in China“, und setzte fort: „Klassentreffen der Diktatoren und Autokraten in China“
Da ist sie wieder – die ideologische Dichotomisierung: „Gegengewicht zu Bündnissen demokratisch regierter Staaten“ und „Diktatorentreffen“. Das mag nach westlichem Demokratieverständnis so sein, ändert aber nichts daran, dass sich die globalen Machtverhältnisse in einer Phase der Neuordnung befinden und solche Aussagen nur in eine Sackgasse, in eine Isolation führen. Die eigene ideologisch bedingte Überhöhung, die Hybris lässt offensichtlich keine andere Rezeption zu, als dass da ein paar „Autokraten“ und „Diktatoren“ zum Aufstand gegen den Westen blasen. Aber so einfach ist es eben nicht. Es muss wieder gelernt werden, in komplexen Zusammenhängen zu denken, eigene Fehler zu reflektieren, realistische Optionen zu identifizieren und strategisch klug zu agieren. Die Voraussetzung hierzu ist es, sich zunächst von der zivilisatorischen Überlegenheitsideologie endlich zu verabschieden, das tief verankerte Blockdenken zu überwinden und offen für ein globales WIR auf Augenhöhe zu stehen, statt den moralischen Zeigefinger zu schwenken und die Polarisierung voranzutreiben. Andernfalls kann auf die Hybris angesichts der neuen Machtrealitäten recht schnell die Nemesis folgen.
Allerdings sind wir von dieser Einsicht, dieser erforderlichen Metamorphose noch weit entfernt. Bislang wird der Epochenbruch westlicherseits vielmehr als Bedrohung denn als Chance verstanden, auf den mit sprachlicher und materieller Aufrüstung und Militarisierung gegenüber den „Autokratien“ und „Diktaturen“ geantwortet werden müsse:
So witterte Trump anlässlich der Militärparade Chinas zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Ostasien und angesichts der Bilder von Xi Jinping mit Kim Jong-un und Wladimir Putin eine Verschwörung gegen die USA:
„Bitte richten Sie Wladimir Putin und Kim Jong-un meine herzlichsten Grüße aus, während Sie sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika verschwören.“
Hintergrund war, dass bei Trump der Eindruck entstand, die Leistungen der USA im Krieg gegen Japan und somit auch zu Gunsten Chinas seien von Xi nicht gewürdigt worden. Tatsächlich wäre es klüger gewesen, auch Trump zur Militärparade einzuladen, um genau diesen nicht ganz unberechtigten Eindruck gar nicht erst entstehen zu lassen.
In diesem Kontext muss die Ankündigung Trumps gesehen werden, das US-Verteidigungsministerium wieder zum Kriegsministerium umzubenennen, da es die Realitäten eher darstelle. Sprache und politische Realitäten bedingen sich halt gegenseitig – Realitäten prägen Sprache und Sprache prägt Realitäten.
Auch in EU-Europa stehen die Zeichen in den Mitgliedsstaaten auf Aufrüstung, da Russland in den nächsten Jahren die europäischen Nachbarstaaten angreifen könnte, so die Erzählung. In Deutschland stehen nach der Sommerpause die politischen und medialen Debatten zum massiven Abbau des Sozialstaates und letztlich zur Finanzierung des Aufrüstungsstaates an.
Die Unfähigkeit, diesen globalen Epochenbruch als Chance zu begreifen, gewissermaßen den Resetknopf für den gemeinsamen Aufbau einer neuen Weltordnung auf Augenhöhe zu drücken, statt ihn durch Militarisierung in die Katastrophe zu lenken, ist bemerkenswert.
Er ist umso bemerkenswerter, als dass bei einem Blick in die Geschichte, ja sogar in die Zeitgeschichte deutlich wird, dass es sich damit auch um eine Kampfansage statt einer ausgestreckten Hand ehemaliger Kolonialländer gegenüber den ehemaligen Kolonien, Halbkolonien und Staaten, die den deutschen Vernichtungskrieg ertragen mussten, handelt. Was haben wir eigentlich in all den letzten Jahrzehnten im schulischen Geschichtsunterricht gelernt?
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO)
Die SCO wurde 2001 von sechs Staaten (Russland, Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und China) gegründet. Zwischenzeitlich sind Indien, Iran, Pakistan und Weißrussland hinzugestoßen, die SCO ist somit zur größten Regionalorganisation geworden, die für rund 40 Prozent der Weltbevölkerung steht. Weitere Staaten besitzen Beobachterstatus, sind Gastteilnehmer oder Dialogpartner, darunter das NATO-Mitglied Türkei. Der Hauptsitz der Organisation ist Peking, China. Dem Selbstverständnis nach widmet sich die SCO nahezu allen politischen Feldern der Region, die einer Förderung der zwischenstaatlichen Kooperation zum Zwecke der Schaffung der regionalen Stabilität bedürfen. Die Schwerpunkte sind sowohl wirtschafts- und handelspolitische als auch sicherheitspolitische Themen des asiatischen Großraumes. Es geht tatsächlich auch darum, den Westen als Gestaltungs- und Machtfaktor aus der kontinentalen Großregion zu verdrängen bzw. fernzuhalten. Der Entscheidungsmodus ist das Konsensprinzip. Wie weit das Konsensprinzip angesichts des Wunsches weiterer Staaten, dem Bündnis beizutreten, auch künftig aufrechtzuerhalten ist, ist offen.
Ziel – eine multipolare Weltordnung
Was wurde auf dem SCO-Gipfel neben den gewollt ausdrucksstarken Bildern entschieden, was den Westen so beunruhigt?
Aufgrund der bislang nicht auf der Homepage der SCO oder anderer Quellen zugänglichen Abschlusserklärung der SCO muss ich auf Sekundärquellen zurückgreifen, die ebenfalls nur Bruchstücke der Erklärung veröffentlichen konnten.
So beschreibt die indische Tageszeitung Economic Times das 25. Gipfeltreffen der SCO als einen außergewöhnlichen Gipfel, als den bislang größten Gipfel mit weitreichenden Beschlüssen. Der chinesische Präsident Xi Jinping habe den Gipfel genutzt, um eine neue Weltordnung auf der Grundlage der Multipolarität, des Multilateralismus und der Führerschaft des Globalen Südens zu verkünden. Es sei ein kalkulierter Schritt gegen die US-zentrierte Globaldominanz gewesen. Die Botschaft Xis Schulter an Schulter mit Modi und Putin sei ein „Gamechanger“.
Neben der Vision einer neuen, auf Multipolarität und Multilateralismus basierenden Weltordnung kündigte die SCO unter der Leitung Xis diverse Programme und Maßnahmen an.
Insgesamt wurden laut diverser Medien sechs Schwerpunktthemen in der Erklärung genannt:
- Fortgesetzter Kampf gegen den Terrorismus
- Forderung nach globaler Gerechtigkeit und Reformen internationaler Regierungsorganisationen wie der UNO, des IWF, der Weltbank, um die neuen Kräfteverhältnisse adäquat darzustellen. Die uneingeschränkte Respektierung der UNO-Charta, hier insbesondere die grundlegenden Normen der staatlichen Souveränität und des Interventionsverbotes. In diesem Kontext auch die uneingeschränkte Ablehnung unilateraler militärischer Maßnahmen – also Betonung des Gewaltverbotes –, hier insbesondere vor dem Hintergrund des jüngsten Krieges Israels und der USA gegen den Iran.
- Einrichtung einer SCO-Entwicklungsbank. Bereitstellung eines Kreditrahmens Chinas für Infrastrukturprojekte und die Öffnung des chinesischen Satellitennavigationsprogramms für SCO-Mitglieder, als Alternative zum US-amerikanischen GPS-System.
- Vertiefte Kooperationen in Forschung und Technologie, inklusive der KI-Entwicklung.
- „One Earth, One Family, One Future“ – Vision auf Anregung Indiens, was diverse, auch kulturelle Kooperationsformen beinhalten soll und dem Titel nach auch offen ist für den Rest der Welt.
- Und die Förderung der Entwicklung hin zu einer multipolaren Weltordnung ohne Konfrontations- und Blockdenken.
Gerade der letzte Punkt dürfte im Westen für Widerspruch sorgen, da er sich selbst durch die SCO ausgeschlossen sieht und den Vorwurf des Blockdenkens spiegelbildlich zurückweisen kann. Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Jedoch könnte diesem Vorwurf mit dem Hinweis entgegnet werden, dass der Westen selbst exklusive Clubs (NATO, EU, G-7) unterhält und hinreichende Reformen der UNO und ihrer Unterorganisationen bislang verweigert, sodass der Nicht-Westen sich gezwungen sehe, alternative regionale und interregionale Formate jenseits westlicher Einflussnahme und Interventionen zu schaffen. Wie auch immer man die Argumentationsspirale weiterdrehen könnte, die offene und spannende Frage ist: Werden SCO und BRICSplus nach entsprechender Konsolidierung offen für westliche Länder sein („One World“), oder werden es tatsächlich im Groben zwei Blöcke werden, der Westen und der Nicht-Westen? Nur dann wäre es keine multipolare, sondern eher eine neue bipolare Weltordnung. Die multipolare Komponente würde erst auf der zweiten Niveauebene zum Ausdruck kommen, da der Nicht-Westen selbst sehr heterogen ist und die Interessensdifferenzen – jenseits des Konsenses der Emanzipation vom Westen – durchaus erheblich sind.
Vieles wird davon abhängen, ob der Westen, aber auch der Nicht-Westen diese neue Weltordnung kooperativ oder konfrontativ gestalten und annehmen werden. Die konfrontative Option wäre das schlechte Szenario. Bislang geht es eher genau in diese Richtung, in Richtung Rivalität – Stichwort Stellvertreterkrieg um die Ukraine und um den Nahen und Mittleren Osten. Sollte sich diese fatale Richtung verfestigen, würde die erste Hälfte des 21.Jahrhunderts eine sehr kriegerische Phase im neuen Weltneuordnungsprozess sein – und darüber dauerhaft schwebend das Damoklesschwert eines Nuklearkrieges.
Titelbild: Der indische Premierminister Narendra Modi spricht mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor dem SCO-Gipfel 2025 im Meijiang Convention Center, Tianjin, China, 1. September 2025 – Quelle: Shutterstock / Photo Agency
Der große Epochenbruch, aber ohne Europa – Wie ideologische Verbohrtheit unsere Zukunft ruiniert
Wie die NATO eine suizidale Zeitbombe beschloss
Das Bundesverfassungsgericht im Zentrum politischer Auseinandersetzungen
Territoriale Integrität der Ukraine – oder die „Weiterentwicklung des Völkerrechts“