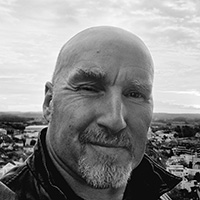„Krieg und Demokratie passen schlecht zusammen. Wenn man zum Beispiel einen ‚Krieg gegen das Virus‘ ausruft, dann kann man damit alle Arten von Grundrechtseinschränkungen legitimieren. Inzwischen wird in Deutschland ja sogar über die Ausrufung eines Spannungsfalles debattiert, also einer Aktivierung der Notstandsgesetze von 1968“, sagt Fabian Scheidler im Interview mit den NachDenkSeiten. Mit seinem neuen Buch „Friedenstüchtig. Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen“ fokussiert Scheidler auf eine Welt, die „aus den Fugen“ geraten ist. Mit Analysekraft und klarem Verstand analysiert Scheidler ineinandergreifende „Krisenprozesse“ und lässt dabei kein gutes Haar an der vorherrschenden Politik. Ein Interview über den permanenten „Ausnahme- und Kriegszustand“ und eine „Strategie der Eskalation“. Von Marcus Klöckner.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Marcus Klöckner: Herr Scheidler, Sie schreiben es gleich zu Beginn Ihres Buches in Anlehnung an Shakespeare: Die Welt ist aus den Fugen geraten. Logik, gesunder Menschenverstand, Maß und Ziel – vor allem die Politik hat damit gebrochen. Längst ist die große Krise ein Dauerzustand und der Ausnahmezustand die Normalität. Der Kampf gegen den Terror, der Kampf gegen das Virus, der Kampf gegen das Klima, der Kampf gegen Russland: Kampf, Krieg, Bedrohung, Gefahr – was hat es mit diesem Programm in Endlosschleife auf sich?
Fabian Scheidler: Die Welt ist tatsächlich aus den Fugen. Wenn wir genauer hinschauen, haben wir es mit drei ineinander verschränkten Krisenprozessen zu tun: erstens einem Niedergang der Vorherrschaft des Westens, der über Jahrhunderte dem größten Teil der Welt seinen Willen aufgezwungen hat; zweitens einem inneren Zerfall westlicher Gesellschaften, die durch Jahrzehnte neoliberaler Politik zerrüttet sind. In den USA ist das besonders deutlich, aber auch in Ländern wie Deutschland sind die Infrastrukturen ruiniert, Massenarmut hat Einzug gehalten. Und drittens handelt es sich um eine Krise der lebenserhaltenden Systeme der Erde, von denen das sich anbahnende Klimachaos nur ein Aspekt ist. Der permanente Ausnahme- und Kriegszustand ist, wie ich in meinem Buch zeige, ein Versuch, diese Krisenprozesse autoritär und militärisch zu beherrschen. Nach außen hin sollte bereits durch den sogenannten „Krieg gegen den Terror“ und nun durch die beispiellose Aufrüstung die bröckelnde westliche Dominanz wiederhergestellt werden. Nach innen dient der latente Kriegszustand dazu, Widerspruch zu unterdrücken und davon abzulenken, dass die Politik eigentlich am Ende ist, dass sie keine Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit hat.
Umfragen zeigen ja sehr klar, dass das Vertrauen in Regierung und Parteien extrem gering ist. In einer solchen Situation kann es sehr nützlich sein, auf äußere Feinde zu verweisen, ihr Bedrohungspotenzial ins Unermessliche zu steigern, Ängste zu schüren und damit die Gesellschaft hinter ihren politischen Führern zu versammeln. Ich spreche von einer regelrechten Kriegsmythologie, die den jeweils aktuellen Feind – ob es Saddam Hussein ist, der islamistische Terror, die Hamas oder Putin – als eine durch und durch dämonische Kraft, als eine Inkarnation des Erzbösen darstellt, die die Grundfeste unserer Zivilisation bedroht und die es mit allen Mitteln zu bekämpfen gilt. Dadurch werden Abwägungsprozesse und differenzierendes Denken ausgeschaltet, die Welt zerfällt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse nach dem Muster von plumpen Hollywood-Blockbustern. Rationale Debatten und rationale Politik werden so unmöglich. Das war in ähnlicher Form auch in der Pandemie zu beobachten.
Damit sind wir dann wohl auch bei dem Begriff „Zeitenwende“ angelangt. Was bedeutet es, wenn Merz und Co. diesen Begriff gebrauchen? Es war düster und es wird noch düsterer?
Eine Zeitenwende würden wir angesichts der extremen sozialen Ungleichheit, dem Niedergang der öffentlichen Daseinsvorsorge, der sich verschärfenden ökologischen Krisen und der Kriegsgefahren tatsächlich dringend brauchen. Als aber Bundeskanzler Scholz diesen Begriff im Februar 2022 in den Raum stellte, meinte er etwas ganz anderes, nämlich Aufrüstung und die Abkehr von der Politik der Entspannung und Gemeinsamen Sicherheit, die von der SPD in den 1970er- und 80er-Jahren entscheidend mitgeprägt wurde und die wesentlich zur friedlichen Beendigung des Kalten Krieges und zur Wiedervereinigung beigetragen hat. Die SPD hat die russische Invasion in der Ukraine zum Anlass genommen, diese Tradition endgültig zu entsorgen und ausschließlich auf Konfrontation zu setzen. Heute heißt es bisweilen sogar, die Entspannungspolitik habe Mitschuld an der russischen Invasion, weil sie Russland durch Naivität zu viel Spielraum verschafft habe. Das ist Geschichtsklitterung, das Gegenteil ist der Fall. Nach der Wende bot Michail Gorbatschow die Vision einer neuen europäischen Sicherheitsordnung an – das „gemeinsame europäische Haus“, das auf zivilen Organisationen wie der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ruhen sollte. Der französische Präsident François Mitterand schlug vor, die NATO, die damals keine Funktion mehr hatte, aufzulösen. Doch die Neokonservativen auf beiden Seiten des Atlantiks sabotierten dieses Programm und setzten auf NATO-Osterweiterung. Das war bereits die Vorbereitung der Zeitenwende und der Weg in die neue Blockkonfrontation. Heute weigert sich die Regierung, mit Moskau auch nur zu reden – eine unverantwortliche Haltung angesichts der enormen Gefahr einer Eskalation.
Längst lautet die politische Losung „Kriegstüchtigkeit“. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein solches politisches Großvorhaben in Deutschland geradezu undenkbar gewesen. Passt das für Sie zur allgemeinen Entwicklung?
Angesichts der deutschen Geschichte ist die Selbstverständlichkeit, mit der heute von Kriegstüchtigkeit gesprochen wird, absolut erschreckend. Wenn ein Kanzler Merz verkündet, er habe keine Angst vor einem Krieg mit Russland, dann muss man sich ernsthaft Sorgen um seinen Geisteszustand und um unser Land machen. Entweder Herr Merz hat keinerlei Interesse an seinem eigenen Überleben und dem seiner Mitmenschen, oder er ist schlicht und ergreifend zu fantasielos, um zu begreifen, was ein Krieg mit Russland bedeuten würde. Schon Günther Anders bemerkte, dass die bei Politikern weit verbreitete Unfähigkeit, sich vorstellen, was ein großer Krieg oder gar ein Atomkrieg bedeutet, ausgesprochen gefährlich ist. Wir erleben in Deutschland nun wieder eine Militarisierung, die in mancher Beziehung an das Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Wenn wir tatsächlich fünf Prozent des Bruttoinlandproduktes für das Militär ausgeben, würde das etwa 50 Prozent des Bundeshaushaltes entsprechen – beim Kaiser waren es 60.
Die Bundeswehr geht in Schulen, ja sogar in Kindergärten, und verbreitet dort ein unkritisches und geschöntes Bild vom Militär. ARD und ZDF machen in ihren Kindersendungen Werbung für die Bundeswehr. Straßenbahnen in Berlin sind in Tarnfarben gestrichen. Und der gesellschaftliche Widerstand ist noch gering. Im Parlament gibt es längst wieder einen „Burgfrieden“, selbst die Linke hat im Bundesrat für die Grundgesetzänderungen zur schrankenlosen Aufrüstung gestimmt. Auch das erinnert an die Zeit vor 1914. Dabei ist das Argument für diese Aufrüstung, nämlich dass Russland vorhabe, NATO-Länder anzugreifen, vollkommen unglaubwürdig. Selbst die US-Geheimdienste sagen unisono in ihrem jährlichen Bericht, dass Russland keinerlei Interesse daran hat. Es wäre ja auch Selbstmord angesichts der erdrückenden Übermacht der NATO. Und wie sollte, selbst wenn die russische Führung suizidal veranlagt wäre, eine russische Armee, die seit Jahren größte Mühe hat, einzelne ostukrainische Dörfer zu erobern, plötzlich Warschau, Berlin und Paris überrollen? Das ist absurd.
Im ersten Teil Ihres Buches setzen Sie sich analytisch mit vier Ereignissen auseinander. Krieg gegen den Terror, Corona, Gaza, Ukraine-Krieg. Dabei haben Sie ein Muster erkannt. Welches Muster ist das, und wie kommt es zustande?
Das Muster, das die Reaktionen auf diese vier Ereignisse verbindet, ist eine Strategie der Eskalation und eines permanenten Ausnahmezustandes, der dazu dient, der Exekutive weitreichende Durchgriffsrechte zu sichern, Dissens zu unterdrücken und enorme Mengen von Geld in die Hände der oberen zehn Prozent zu kanalisieren. Was die Eskalation angeht, so haben die Reaktionen in allen vier Fällen die Ausgangssituation massiv verschlechtert. Der Krieg gegen den Terror antwortete auf ein Verbrechen mit knapp 3.000 Toten durch einen Vernichtungsfeldzug, der ganze Erdregionen in Schutt und Asche gelegt hat und den Terrorismus international geradezu hat explodieren lassen. In Afghanistan etwa sind durch den vom Westen geführten Krieg über 170.000 Menschen gestorben, davon 98 Prozent Afghanen. Lebten vor dem Krieg 80 Prozent in Armut, so sind es heute 97 Prozent. In der Pandemie wurden die destruktiven Strategien des „War on Terror“ zum Teil auf den „Krieg gegen das Virus“, wie Emmanuel Macron es nannte, übertragen. Die martialischen Maßnahmen, vor allem Lockdowns, Schulschließungen und der zu keinem Zeitpunkt epidemiologisch begründbare Ausschluss von Ungeimpften aus dem gesellschaftlichen Leben haben enorme Schäden angerichtet und zur Eindämmung der Pandemie kaum genützt. Das war auch damals alles absehbar.
Im Fall von Gaza wiederholte Israels Feldzug, unterstützt vom Westen, die desaströse Politik des War on Terror und überbot sie noch durch einen regelrechten Völkermord. Das Ergebnis ist für alle Seiten verheerend, am meisten für die Palästinenser, aber auch für Israel selbst: Das Land ist wesentlich unsicherer als zuvor, Hunderttausende wandern ab, und selbst die Unterstützung innerhalb der USA bröckelt. Und schließlich wurde auf die Invasion der Ukraine ausschließlich durch Eskalation geantwortet statt durch Diplomatie. Die Verhandlungen im März und April 2022 in Istanbul, die in einen quasi unterschriftsreifen Zehn-Punkte-Plan mündeten, wurden von den USA und Großbritannien sabotiert, wie der türkische Außenminister und sogar der damalige Verhandlungsführer und Fraktionschef von Selenskyjs Partei einstimmig berichteten. Die Bundesregierung hat ebenfalls von Anfang an jede Form von Diplomatie abgelehnt. Damit trägt der Westen eine Mitschuld daran, dass mittlerweile Hunderttausende an der Front gestorben sind. All das wäre vermeidbar gewesen.
Der Untertitel Ihres Buches lautet ja: „Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen“. Was meinen Sie damit?
Im Buch schreibe ich, dass nicht nur die Reaktionen der Politik auf die Ereignisse des letzten Vierteljahrhunderts krisenverschärfend gewirkt haben, sondern die Politik die Feinde, die wir bekämpfen, auch zu einem großen Teil selbst geschaffen hat. Im Fall des Terrors ist das besonders offensichtlich, von der Finanzierung der Mudschaheddin in Afghanistan bis zur Unterstützung von Terroristen in Syrien – stets, um geopolitische Gegner zu schwächen. Im Fall von Gaza wurden den Palästinensern über Jahrzehnte elementare Rechte vorenthalten, bevor man sie dann für 16 Jahre in Gaza völkerrechtswidrig eingesperrt hat. So erzeugt man Gewalt. Russland hätte auch nicht zu dem Feind des Westens, der es heute ist, werden müssen, wenn man die Politik der Gemeinsamen Sicherheit weiterverfolgt hätte. Und selbst das Corona-Virus ist, wie ich im Buch detailliert beschreibe, möglicherweise aus einer vollkommen unverantwortlichen Laborforschung hervorgegangen, dafür gibt es immer mehr Indizien.
Sie sagen, dass die negativen Folgen aus den Ereignissen gar nicht hätten so negativ sein müssen. Vielmehr waren es aus Ihrer Sicht das Verhalten und die Reaktionen der Politik, die eine enorme zerstörerische Kraft entfaltet haben. Wie erklären Sie sich das? Im Grunde sind wir mit Ihrer Erkenntnis wieder bei der ersten Frage unseres Interviews. Vielen Bürger fällt auf, dass die Politik mit dem gesunden Menschenverstand gebrochen hat, dass sie Logik ignoriert usw. Nehmen wir als Beispiel den Krieg in der Ukraine. Für jeden halbwegs vernünftigen Analysten war von Beginn an abzusehen, dass die Politik der Konfrontation gerade nicht zu einer schnellen Beendigung des Krieges führen würde. Heute, nachdem die Opferzahlen in die Hunderttausende oder gar Millionen gehen, ist es noch offensichtlicher. Dennoch: Die Politik marschiert unaufhaltsam auf ihrem eingeschlagenen Weg weiter. Also nochmal die Frage: Warum? Was sind die Gründe für eine Politik, die keinen Sinn zu ergeben scheint?
In Brüssel und vielen europäischen Hauptstädten herrscht Panik, weil man zum einen sieht, dass das Zeitalter der westlichen Hegemonie zu Ende geht und sich immer mehr Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika, von deren Ausbeutung der Westen lange gelebt hat, von unseren Regierungen abwenden, dass sie nicht mehr so erpressbar sind wie einst. Das hat natürlich mit dem Aufstieg der BRICSplus zu tun, die schon heute ökonomisch stärker sind als die G7. Zum anderen erweist sich der große Bruder in Washington, dem man sich besonders in Deutschland, aber auch anderswo in der EU bisher bedingungslos unterworfen hat, als immer unberechenbarer. Die USA zögern keine Sekunde, die EU gegen die Wand fahren zu lassen, wenn es für sie gerade ökonomisch oder geopolitisch opportun ist. In dieser Lage suchen die dominierenden politischen Kräfte in der EU ihr Heil in einer schrankenlosen, in der Tat panischen Aufrüstung, um ihre Position aufrechtzuerhalten, ohne sich jedoch von der Unterwürfigkeit gegenüber den USA zu lösen. Die Aufrüstung hat aber noch einen zweiten Hintergrund: Sie erlaubt die rasche Demontage des Sozialstaates, den alle deutschen Regierungen der letzten Jahrzehnte bereits ausgehöhlt haben, wobei sie aber immer wieder auf Widerstand stießen. Die angebliche Bedrohung durch eine russische Invasion dient nun dazu, diesen Widerstand zu brechen. Die Financial Times brachte es im Frühjahr in einer Titelzeile auf den Punkt: „Die EU muss ihren Wohlfahrtsstaat zurechtstutzen, um einen Kriegsstaat aufzubauen“. Das ist das Programm, und davon profitiert natürlich vor allem der militärisch-industrielle Komplex.
Was bedeutet denn die Gesamtentwicklung aus demokratischer Sicht? Was passiert im Inneren der Länder, Stichworte Zensur und Überwachung?
Krieg und Demokratie passen schlecht zusammen. Wenn man zum Beispiel einen „Krieg gegen das Virus“ ausruft, dann kann man damit alle Arten von Grundrechtseinschränkungen legitimieren. Wir sehen in allen vier Fällen eine ähnliche Strategie des Power Grabbing, die der Exekutive und der Polizei mehr Macht gibt, Bürgerrechte einschränkt und Überwachung ausweitet. Inzwischen wird in Deutschland ja sogar über die Ausrufung eines Spannungsfalles debattiert, also einer Aktivierung der Notstandsgesetze von 1968. Typisch sind auch Ad-hoc-Gesetze und Verfassungsänderungen nach dem Muster der von Naomi Klein sehr gut beschriebenen „Schockstrategie“. Hinzu kommt eine immer massivere Verengung des Debattenraumes, indem man Abweichler diffamiert. Mit jeder neuen Krise kommen neue diffamierende Etikettierungen hinzu, mit denen Argumente ersetzt werden und die einzig und allein dazu dienen, Dissidenten mundtot zu machen. Der Digital Services Act der EU öffnet darüber hinaus auch das Tor für die Zensur des Internets, indem ausdrücklich auch legale Inhalte indiziert werden können.
Sehen Sie Möglichkeiten, wie diese Entwicklungen aufgebrochen werden können?
Der permanente Ausnahmezustand und die Kriegslogik funktionieren nur so lange, wie die Bevölkerung weitgehend in Angststarre verbleibt und die Propaganda glaubt. Wenn zum Beispiel Schüler, Lehrer und Hochschullehrer sich gegen die Militarisierung ihrer Institutionen erheben und das Narrativ von einem baldigen russischen Einmarsch hinterfragen würden, wäre es für die Politik nicht mehr so einfach, durchzuregieren und die Gesellschaft auf einen Krieg vorzubereiten. Die 153 Milliarden Euro, die Merz und Klingbeil ab 2029 jährlich für das Militär ausgeben wollen, sind auch noch lange nicht finanziert. Die Regierung wird versuchen, das nicht nur über Schulden, sondern auch über einen weiteren Abbau des Sozialstaates zu bezahlen. Wenn sich Sozialverbände, Gewerkschaften und große Teile der Bevölkerung dagegen vehement auflehnen, wie man das zum Teil in Frankreich und Großbritannien beobachten konnte, wo Kürzungspakete im Namen der Aufrüstung nicht durch die Parlamente kamen, dann lässt sich auch hier noch einiges verhindern.
Außenpolitisch kommt es darauf an, zu einer realistischen Politik, einer Politik der Gemeinsamen Sicherheit zurückzukehren, so schwer das heute auch sein mag. Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden, und Sicherheit kann es im Nuklearzeitalter nur mit und nicht gegen Russland geben, ganz gleich, was wir von der Regierung im Kreml halten. Gemeinsame Sicherheit bedeutet, dass nicht allein die USA, die Ukraine, Deutschland, Israel und andere Staaten des westlichen Blocks ein Recht darauf haben, dass ihre Sicherheitsinteressen gewahrt werden, sondern auch Russland, China, die Palästinenser, Venezuela und Kolumbien. Würde man dieses Prinzip konsequent anwenden, dann ließe sich der größte Teil der Konfliktherde entschärfen. Allerdings versucht der Westen mit aller Macht, seine dominierende Rolle und die damit verbundenen doppelten Standards aufrechtzuerhalten. Langfristig wird dies aber nicht gelingen, denn die demographischen und ökonomischen Trends werden unweigerlich die Multipolarität stärken. Eine rationale europäische Politik würde diese Realität akzeptieren und versuchen, die EU zu einer diplomatischen Kraft zwischen den großen Mächten zu machen, statt auf Konfrontation zu setzen, bei der sie nur verlieren können, und sich an das zerfallende US-Empire zu ketten.
Über den Interviewpartner: Fabian Scheidler ist freischaffender Autor und arbeitet u.a. für Le Monde diplomatique. Sein Buch „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation“ wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sein neues Buch „Friedenstüchtig. Wie wir aufhören können, unsere Feinde selbst zu schaffen“ ist gerade im Wiener Promedia Verlag erschienen. 2009 erhielt er den Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus.
Titelbild: „Kinder in preußischen Armeeuniformen, um 1900“, in: Historische Bilddokumente