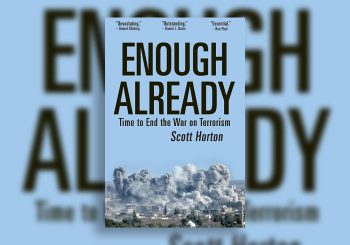Scott Hortons Meisterwerk „Enough Already“ zeigt, wie die USA und ihre Verbündeten Verwüstung in Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen, Libyen, Somalia und Pakistan verbreiteten, indem sie Despoten stützten und Extremisten bewaffneten. Die endgültige Bilanz: zwei Millionen Tote, 37 Millionen Vertriebene und eine Welt, die gefährlicher geworden ist als zuvor. Eine Rezension von Michael Holmes.
Scott Horton – Chefredakteur von Antiwar.com und Moderator der legendären Scott Horton Show mit über 6.000 Interviews – ist einer der profundesten Kritiker der US-Außenpolitik seit dem 11. September. Sein faktenreiches und fesselndes Buch „Enough Already: Time to End the War on Terror“ aus dem Jahr 2021 ist eine der umfassendsten Darstellungen des sogenannten Krieges gegen den Terror: In einer präzisen Chronologie zeigt Horton, wie die USA und ihre Verbündeten nach den Anschlägen vom 11. September eine globale Spirale von Interventionen auslösten, die nicht nur Millionen von Opfern forderte, sondern oft auch selbst „Kriege gegen den Terror“ hervorbrachte – durch die Unterstützung radikaler Islamisten in Syrien und anderswo. Von den Irakkriegen über Afghanistan, Libyen und Somalia bis hin zum Völkermord im Jemen bietet Hortons Werk einen unerschrockenen Überblick über die amerikanischen Kriege des 21. Jahrhunderts.
Wer verstehen will, warum Washington nach dem 11. September systematisch Kriege geführt hat, die seine eigenen Feinde gestärkt haben, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Es ist eine Anklage von unerbittlicher moralischer Kraft, die sich wie eine Beweisaufnahme der Staatsanwaltschaft liest. Hortons zentrale These ist ebenso einfach wie vernichtend: Die schmutzigen Kriege im Irak, in Afghanistan, Pakistan, Syrien, Jemen, Libyen und Somalia haben die terroristische Bedrohung verstärkt, die dann als Vorwand für weitere Interventionen diente. Hortons Verdienst ist es, die verstreuten Fragmente dieser blutigen Geschichte in einer Erzählung zusammenzufassen: die geheimen Abkommen, die Stellvertreterkriege, die Folterprogramme, die Sanktionsregime und die Bombardierungen, deren Ausmaß die westliche Öffentlichkeit nach wie vor stark unterschätzt. Er macht deutlich, dass die eigentliche Kontinuität in der US-Politik nicht Demokratie oder Menschenrechte waren, sondern die Partnerschaft mit der Besatzung Israels, brutalen Diktaturen in Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten, Ägypten, Jordanien, der Türkei und Pakistan sowie mit Warlords und Milizen, deren Verbrechen denen unserer offiziellen Feinde in nichts nachstanden. Das Ergebnis war ein Kreislauf der Gewalt, der mehr Feinde hervorbrachte, als er vernichtete. Nirgendwo ist dies deutlicher zu sehen als im Irak und in Syrien, wo ein Krieg in den nächsten überging und wo die amerikanische Macht nicht nur den Terrorismus nicht besiegen konnte, sondern sogar dessen monströseste Inkarnation in Form des IS hervorbrachte.
Horton zeigt auch, dass der Krieg gegen den Terror ebenso oft ein Krieg für den Terror war. Immer wieder bewaffneten, finanzierten und legitimierten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten genau die extremistischen Fraktionen und Diktaturen, deren Verbrechen dann als Rechtfertigung für den nächsten Krieg herangezogen wurden. Mit fast grimmiger Konsequenz wurden Regime oder Gruppen, die Washington in einem Jahrzehnt verteufelte, in einem anderen als Klienten oder Stellvertreter gepflegt. Horton argumentiert, dass dies keine Reihe von Fehlern oder Zufällen war – es war die Logik des Imperiums, die auf die muslimische Welt angewendet wurde, mit katastrophalen Folgen.
Wurzeln im Kalten Krieg: Diktatoren und Dschihadisten als Klienten
Um den Krieg gegen den Terror zu verstehen, muss man laut Horton vor 2001 beginnen. Das Muster, sowohl Dschihadisten als auch Diktatoren als Instrumente der US-Politik zu unterstützen, wurde im Kalten Krieg festgelegt. In Afghanistan flossen in den 1980er-Jahren aus Washington, Saudi-Arabien und Pakistan Geld und Waffen in die fanatischsten Mudschaheddin-Fraktionen. Gulbuddin Hekmatyar, berüchtigt dafür, dass er unverhüllten Frauen Säure ins Gesicht schüttete, war einer der bevorzugten Klienten der CIA. Jalaluddin Haqqani, späterer Chef des mit Al-Qaida verbündeten Haqqani-Netzwerks, war ein weiterer. Arabische Freiwillige, die sich dem Dschihad anschlossen – darunter Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri – konnten Netzwerke, Trainingslager und Finanzierungswege aufbauen, die zur Infrastruktur von Al-Qaida wurden. Was als Versuch begann, die Sowjets auszubluten, hinterließ ein Frankenstein-Monster des transnationalen Dschihad.
Die gleiche zynische Logik galt auch am Golf. Als Saddam Hussein 1980 in den Iran einmarschierte, neigte Washington zu Bagdad, lieferte Satelliteninformationen und diplomatische Deckung, während westliche Firmen die chemischen Vorprodukte verkauften, die Saddams Gasarsenal versorgten. Seine schlimmsten Gräueltaten – die Vergasung iranischer Truppen und kurdischer Zivilisten in Halabja – wurden begangen, während er praktisch unser Kunde war. Die USA entdeckten ihre Empörung erst wieder, als Saddam diese Waffen gegen Kuwait einsetzte und damit die Ordnung verriet, die er eigentlich hätte aufrechterhalten sollen. Horton betont dieses Muster, weil es sich mit betäubender Regelmäßigkeit wiederholt: Der Verbündete von gestern ist der „neue Hitler“ von morgen, und die Erinnerung an unsere Mitschuld wird immer aus der offiziellen Darstellung getilgt.
Die Architektur der amerikanischen Macht im Nahen Osten beruhte auf Partnerschaften mit autoritären Regimes. Saudi-Arabien exportierte den Wahhabismus ins Ausland, während es im eigenen Land Dissidenten enthauptete. Die Militärdiktatur Pakistans und der ISI [Militärischer Geheimdienst Pakistans, Anm. d. Red.] waren sowohl Kanäle für US-Hilfe an Dschihadisten als auch Förderer ihrer eigenen islamistischen Netzwerke. Jordaniens Mukhabarat-Staat, Mubaraks Ägypten – alle wurden mit US-Hilfe und Waffen gestützt. Israel besetzte brutal Palästina, Teile des Libanon und Syrien. Die Türkei, ein NATO-Verbündeter, führte lange Zeit schmutzige Aufstandsbekämpfungskampagnen gegen die Kurden durch, die in Staatsterrorismus ausarteten. Das waren keine Ausnahmen, sondern die Säulen der sogenannten „regelbasierten Ordnung“. Und sie garantierten, dass jede Intervention der USA in der Region eine enge Zusammenarbeit mit genau den Kräften – Diktatoren und Extremisten – bedeutete, die Gewalt und Unterdrückung aufrechterhielten.
Horton betont, dass es bei Al-Qaidas Krieg gegen die Vereinigten Staaten nie um abstrakte religiöse Ideologie ging, sondern um eine direkte Reaktion auf Washingtons eigene Politik im Nahen Osten. Osama bin Ladens Reden enthielten eine klare Liste von Beschwerden: die Massenmorde an Irakern unter dem von den USA unterstützten Sanktionsregime, die dauerhafte Stationierung amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien nach dem Golfkrieg und die unkritische Unterstützung der USA für Israels Verbrechen in Palästina und im Libanon. Diese Politik, erklärt Horton, war keine Randerscheinung, sondern wurde in der gesamten arabischen und muslimischen Welt wahrgenommen und lieferte Al-Qaida das Narrativ, das sie für ihre Rekrutierung benötigte.
Der erste Irakkrieg und das Sanktionsregime: Die Belagerung einer Nation
Der erste Irakkrieg legte das Muster für die folgenden Jahrzehnte fest. Horton zeigt, dass Saddams Invasion in Kuwait wahrscheinlich durch Verhandlungen hätte rückgängig gemacht werden können – Bagdad bot einen Rückzug im Austausch für Gespräche über Ölstreitigkeiten an –, aber Washington, beflügelt vom Ende des Kalten Krieges, entschied sich dafür, den Krieg zu einem Spektakel der neuen imperialen Macht zu machen. Die Kampagne wurde im Inland als klarer Sieg verkauft. In Wirklichkeit war sie alles andere als das.
Als sich die irakischen Truppen im Februar 1991 aus Kuwait zurückzogen, verwandelten US-Flugzeuge die Küstenstraße in ein Schlachtfeld. Die berüchtigte „Straße des Todes” hinterließ kilometerlange Spuren verkohlter Leichen und ausgebrannter Fahrzeuge – Wehrpflichtige und Plünderer, die nicht im Kampf, sondern auf dem Rückzug verbrannt wurden. Gleichzeitig zerstörten die USA gezielt die zivile Infrastruktur des Irak: Kraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen, Brücken und Lebensmittellager. Das Ziel war, wie Studien des Pentagon nach dem Krieg einräumten, das Leben der Zivilbevölkerung unerträglich zu machen, um den Irak nicht nur militärisch, sondern auch sozial zu schwächen. Es folgten Krankheiten und Entbehrungen. Als im Süden und Norden Aufstände gegen Saddam ausbrachen – Rebellionen, die von George H. W. Bush offen unterstützt wurden –, schauten die amerikanischen Streitkräfte tatenlos zu und erlaubten Saddam sogar, Hubschrauber einzusetzen, um sie niederzuschlagen. Zehntausende wurden abgeschlachtet, ein Verrat, der Washingtons wahre Absichten offenbarte: Ein geschwächter und in Schach gehaltener Saddam war einer revolutionären Veränderung, die den Iran stärken könnte, vorzuziehen.
Der Krieg endete nicht 1991. Er verwandelte sich in eine jahrzehntelange Belagerung. Das von den Vereinten Nationen verhängte, aber auf Drängen Washingtons durchgesetzte Sanktionsregime war laut Horton eine Form der kollektiven Bestrafung von beispiellosem Ausmaß. Lebenswichtige Medikamente, Chemikalien zur Wasseraufbereitung und sogar Bleistifte wurden als „doppelt verwendbar“ eingestuft und blockiert. Die Unterernährung nahm zu, Krankenhäusern gingen grundlegende Medikamente aus und die Kindersterblichkeit stieg sprunghaft an. Horton diskutiert ernsthafte Forschungsergebnisse, wonach mindestens 200.000 Iraker ums Leben kamen. Die Politik zielte darauf ab, eine Gesellschaft zur Unterwerfung zu zwingen. Als Außenministerin Madeleine Albright erklärte, dass „der Preis es wert ist”, offenbarte sie die moralische Bankrotterklärung eines Systems, das bereit war, eine Generation von Kindern geopolitischen Kalkülen zu opfern. Es war eine Belagerungskriegsführung unter dem Banner des Völkerrechts, die den Boden für den nächsten Krieg bereitete, indem sie den Irak gebrochen, gedemütigt und verzweifelt zurückließ.
Afghanistan nach 2001: Folter und Kriegsherren
Auf den 11. September hätte man mit einer gezielten Operation gegen Al-Qaida reagieren können. Die Taliban boten sogar an, Bin Laden an ein Drittland auszuliefern, wenn ihnen Beweise vorgelegt würden. Washington lehnte dies ab. Stattdessen begann es einen Krieg zur Herbeiführung eines Regimewechsels und eine zwanzigjährige Besatzung, die von Folter, Drohnenangriffen und der Stärkung einiger der berüchtigtsten Kriegsherren der Region geprägt war.
Der Fall Kabuls im Jahr 2001 war nicht die Befreiung, wie sie in den westlichen Medien dargestellt wurde, sondern die Wiederherstellung der Nordallianz – einer Konstellation von Kriegsherren mit blutiger Vergangenheit aus den Bürgerkriegen der 1990er-Jahre. Abdul Rashid Dostum, dessen Männer Tausende von Taliban-Gefangenen in Metallcontainern in Dasht-i-Leili erstickt hatten, wurde auf die Gehaltsliste der CIA gesetzt. Mohammad Fahim, Atta Noor und Ismail Khan – alle wegen Massakern, Vergewaltigungen und ethnischer Säuberungen angeklagt – wurden wieder als „Partner” der USA eingesetzt. Afghanen, die vor ihrer Herrschaft geflohen waren, kehrten zurück und fanden dieselben Raubtiere wieder an der Macht vor, nun gekleidet in die Rüstung der amerikanischen Unterstützung.
Die USA bauten einen globalen Folterarchipel auf, und Afghanistan stand im Zentrum. Die Bagram Air Base wurde zum Synonym für Schläge, Stresspositionen und Häftlinge, die tot in ihren Zellen aufgefunden wurden. Als Folter keine Informationen hervorbrachte, wandte sich Washington der Ermordung zu. Das Drohnenprogramm wurde von Afghanistan aus erweitert und tötete nicht nur gezielte Militante, sondern auch Hochzeitsgesellschaften, Beerdigungen und Familienkomplexe. Sogenannte „Signature Strikes“ töteten Männer im wehrfähigen Alter, weil sie sich wie Afghanen verhielten – sie trugen Gewehre und bewegten sich in Gruppen fort. Ganze Provinzen lebten unter dem Lärm der Drohnen, Kinder waren traumatisiert vom Summen am Himmel. Jeder Angriff tötete nicht nur seine unmittelbaren Opfer, sondern rekrutierte auch ihre überlebenden Verwandten für den Aufstand. Horton zeigt, wie der Krieg zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf wurde: Gewalt brachte Aufständische hervor, Aufständische rechtfertigten weitere Gewalt.
Nach zwei Jahrzehnten war das Ergebnis klar. Die Taliban, die wir angeblich gestürzt hatten, kehrten an die Macht zurück. Die Regierung in Kabul brach unter dem Gewicht von Korruption und Lügen zusammen – genau die Mängel, die US-Beamte seit Langem kannten, aber in den später als „Afghanistan Papers“ berüchtigten Dokumenten verschwiegen hatten. Was blieb, war eine zerstörte Gesellschaft: Massengräber, Amputierte, Traumata und eine Bevölkerung, die der Herrschaft derer ausgeliefert war, die wir angeblich gestürzt hatten. Das war keine Befreiung. Es war der Ersatz einer Form des Terrors durch eine andere, wobei jeder Schrecken die Handschrift der Amerikaner trug.
Der zweite Irakkrieg: Aggression, Besatzung und sektiererische Säuberung
Wenn Afghanistan Amerikas Abhängigkeit von Warlords und Folter offenbart hat, dann war der Irak das ultimative Verbrechen: ein auf Lügen basierender Angriffskrieg. Es gab keine Massenvernichtungswaffen, kein Atomprogramm, keine Allianz zwischen Saddam und Al-Qaida. Der Fall wurde auf gefälschten Dokumenten und erzwungenen Geständnissen aufgebaut und dann mit einer Propagandakampagne verkauft. Horton ist schonungslos: Nach den Maßstäben von Nürnberg war es ein Angriffskrieg wie aus dem Lehrbuch.
Die Invasion begann mit „Schock und Ehrfurcht” – ein Ausdruck, der den Terror aus der Luft verschleierte. Bomben trafen Bagdads Kraftwerke, Brücken und Regierungsgebäude. Die Zahl der zivilen Opfer stieg sofort an. Falludscha wurde zum Symbol für die Brutalität der Besatzung. Zweimal im Jahr 2004 belagerten US-Streitkräfte die Stadt. Beim zweiten Angriff, der „Operation Phantom Fury“, regneten Artillerie, Luftangriffe und weißer Phosphor auf die Stadtviertel. Krankenhäuser wurden angegriffen, Krankenwagen blockiert und Familien in ihren Häusern verbrannt aufgefunden. Die Stadt lag in Trümmern, vergiftet durch abgereichertes Uran und andere Munition, und die Einwohner litten noch Jahre später unter steigenden Krebsraten.
Der berüchtigtste Skandal der Besatzung, Abu Ghraib, war keine Ausnahmeerscheinung, sondern ein Einblick in eine systematische Politik. Der Mann mit der Kapuze auf der Kiste, die nackten Pyramiden aus Gefangenen, die sexuellen Demütigungen – all dies waren oberflächliche Anzeichen für einen tiefer liegenden Mechanismus des Missbrauchs. Im Camp Nama, in Forward Operating Bases und in geheimen CIA-Gefängnissen wurden Waterboarding, Schlafentzug und Schläge praktiziert. Dabei ging es nicht um Geheimdienstinformationen, sondern um Unterwerfung, und die Folge war die Radikalisierung einer ganzen Generation von Gefangenen.
Das vielleicht nachhaltigste Verbrechen war die Unterstützung der sektiererischen Säuberung. Nachdem sie den irakischen Staat zerschlagen und seine Armee aufgelöst hatten, wandten sich US-Beamte den schiitischen Milizen als Kontrollinstrumenten zu. Die Badr-Brigade, Asa’ib Ahl al-Haq und andere paramilitärische Gruppen wurden in Einheiten des Innenministeriums wie die Wolf-Brigade integriert, die Todesschwadronen leitete, die sunnitische Männer folterten, drillten und hinrichteten und ihre Leichen am Straßenrand entsorgten. Bagdad wurde durch Sprengschutzwände und Kontrollpunkte in konfessionelle Kantone aufgeteilt. Eine einst gemischte Stadt wurde durch Angst und Blut geteilt. Dies war kein Kollateralschaden, sondern die Architektur der Besatzung, die mit US-amerikanischer Finanzierung und Aufsicht errichtet wurde.
Strategisch gesehen erreichte der Krieg das Gegenteil seiner erklärten Ziele. Er lieferte Bagdad an iranisch orientierte Parteien und Milizen aus. Anstatt den Terrorismus zu zerschlagen, schürte er einen sunnitischen Aufstand, der, brutal unterdrückt sowohl durch die Besatzung als auch durch schiitische Todesschwadronen, sich zur Al-Qaida im Irak und schließlich zum IS entwickeln sollte. Horton ist sich sicher: Die Invasion von 2003 war nicht nur an sich ein Verbrechen – sie setzte auch genau die Kräfte in Gang, die die nächste Runde von Kriegen in Syrien und erneut im Irak befeuern würden.
Die große Umorientierung: Von der Stärkung der Schiiten zur Bewaffnung der Dschihadisten
Die Katastrophe im Irak hat nicht nur ein Land zerstört. Sie hat die gesamte Region neu geformt. Durch die Einsetzung schiitischer Parteien und Milizen in Bagdad hat die USA dem Iran das größte geopolitische Geschenk seiner modernen Geschichte gemacht. Die Verbündeten Teherans regierten nun den Irak, befehligten seine Ministerien und kontrollierten seine Straßen. Für Washington war dieses Ergebnis unerträglich. Nachdem sie einen Glaubenskrieg ausgelöst hatten, beschlossen die US-Strategen, das Gleichgewicht wiederherzustellen – nicht durch eine direkte Konfrontation mit dem Iran, sondern durch die Stärkung sunnitischer Verbündeter und, fatalerweise, genau jener Dschihadistenfraktionen, die einst unter dem Banner der Al-Qaida gekämpft hatten.
Dies war die Strategie, die Seymour Hersh als „Great Redirection“ (große Neuausrichtung) bezeichnete und die Horton mit vernichtender Klarheit darlegt. Die Logik war einfach: Wenn die schiitische Macht im Irak, in Syrien, im Jemen und im Libanon zunahm, würden sich die Vereinigten Staaten noch enger mit den sunnitischen Staaten – Saudi-Arabien, Katar, der Türkei und Jordanien – verbünden und deren bevorzugte Stellvertreter unterstützen. In der Praxis bedeutete dies, radikalen islamistischen Gruppen Geld, Waffen und politischen Schutz zukommen zu lassen. Diese Politik war ein groteskes Spiegelbild der „afghanischen Falle“ der 1980er-Jahre: Wieder einmal setzten Washington und seine Verbündeten Dschihadisten als Fußsoldaten ein, nur dass diesmal das Schlachtfeld das Herz der arabischen Welt war.
Syrien: Ein Krieg für den Terror
Nirgendwo kam diese Politik so zerstörerisch zum Ausdruck wie in Syrien. Als 2011 Proteste ausbrachen, reagierte das Assad-Regime mit brutaler Gewalt. Aber fast sofort schalteten sich externe Mächte ein, um den Aufstand zu beeinflussen. Die CIA richtete geheime Operationszentren mit türkischen, saudischen und katarischen Geheimdiensten ein und schleuste Waffen über die Grenze. Horton dokumentiert, dass ein Großteil dieser Waffen in die Hände von Dschihadistengruppen gelangte – genau den Fraktionen, die am besten in der Lage waren, vor Ort zu kämpfen.
Die Freie Syrische Armee wurde in den westlichen Medien als säkulare Alternative dargestellt, aber in Wirklichkeit war sie nur eine Marke, eine bequeme Flagge, unter der islamistische Brigaden operierten. Washingtons regionale Verbündete, allen voran die Türkei, bevorzugten Gruppen wie Ahrar al-Sham und die Al-Nusra-Front, den syrischen Ableger von Al-Qaida. Saudi-Arabien und Katar zahlten die Gehälter, der türkische Geheimdienst öffnete die Grenzen, und jordanische Stützpunkte wurden zu Ausbildungsstätten der CIA. Amerikanische Beamte wussten genau, wer ihre Stellvertreter waren. In freigegebenen Dokumenten der Defense Intelligence Agency aus dem Jahr 2012 wurde vorausgesagt, dass im Osten Syriens ein „salafistisches Fürstentum” entstehen könnte – und dies wurde als Möglichkeit begrüßt, Assad zu schwächen. Dieses Fürstentum sollte später zum IS werden.
Das Schreckliche an Syrien war nicht nur das Ausmaß des Krieges – eine halbe Million Tote, Millionen Vertriebene –, sondern auch die Tatsache, dass die Politik des Westens mit seinen brutalsten Elementen verflochten war. Al-Nusra führte in Idlib eine Herrschaft nach Taliban-Art ein, amputierte Hände, richtete Gefangene hin und zerstörte christliche und alawitische Dörfer. Der IS, der im Chaos des Irak und Syriens entstanden war, rief ein Kalifat aus und filmte Enthauptungen. Doch diese Gruppen wuchsen gerade deshalb, weil die USA und ihre Verbündeten Syrien mit Waffen überschütteten und die Übernahme der Rebellion durch die Dschihadisten ignorierten. Unsere Verbündeten vor Ort waren keine Demokraten, sondern Männer, die ihre Gegner kreuzigten, jesidische Frauen verschleppten und religiöse Minderheiten massakrierten.
Als ISIS 2014 über die irakische Grenze vorstieß, Mossul einnahm und die von den Amerikanern ausgebildete irakische Armee in die Flucht schlug, war dies das direkte Ergebnis dieser Politik. Hortons Argument ist vernichtend: Im Namen der Terrorismusbekämpfung hatte Washington den mächtigsten Terrorstaat der modernen Geschichte ins Leben gerufen. Syrien beweist mehr als jeder andere Schauplatz seine These, dass der Krieg gegen den Terror allzu oft ein Krieg für den Terror war.
Irakkrieg III: Die Rückkehr zum Schlachthaus
Der Aufstieg des IS löste den dritten Krieg der USA im Irak aus, der erneut als Kreuzzug gegen die Barbarei verkauft wurde. In Wirklichkeit war es die Fortsetzung eines Kreislaufs, den Amerika selbst ausgelöst hatte. Nachdem Washington 2003 den Irak zerstört, schiitische Todesschwadronen gestärkt und dann sunnitische Dschihadisten in Syrien unterstützt hatte, erklärte es sich nun zur unverzichtbaren Kraft, um das Feuer zu löschen, das es selbst gelegt hatte.
Der Krieg gegen den IS wurde größtenteils mit Luftwaffe, Artillerie und Stellvertretermilizen geführt. Städte wie Mossul, Ramadi und Falludscha wurden in Kampagnen zerstört, die ganze Stadtteile dem Erdboden gleichmachten. Zivile Opfer wurden als „Kollateralschäden“ abgetan, selbst wenn Luftangriffe Familien vernichteten, die in Kellern Schutz gesucht hatten. Menschenrechtsgruppen dokumentierten Tausende von Toten, aber die westliche Öffentlichkeit nahm das Gemetzel kaum wahr. Was zählte, war die Optik des Kampfes gegen den IS, nicht die Realität der Zerstörung sunnitischer Städte.
Vor Ort stützte sich die USA auf kurdische Kräfte im Norden und schiitische Milizen im Süden. Die kurdischen Peschmerga wurden in den westlichen Medien als Helden gefeiert, aber in der Praxis umfassten ihre Kampagnen auch ethnische Säuberungen arabischer Dörfer unter dem Deckmantel des Krieges. Die schiitischen Volksmobilisierungskräfte, von denen viele mit dem Iran verbündet waren, verübten Massaker und summarische Hinrichtungen in sunnitischen Gebieten. Horton unterstreicht die bittere Ironie: Um den IS zu besiegen, stärkte Washington erneut sektiererische Milizen, deren Brutalität sich nicht von der der Dschihadisten unterschied. Die Besetzung von Mossul mag das Kalifat beendet haben, aber sie vertiefte die Wunden, die zu seiner Entstehung geführt hatten.
Das Muster: Dämonisieren, unterstützen, wiederholen
Was sich aus Hortons Bericht über Syrien und den Irak ergibt, ist ein Muster, das so grotesk ist, dass es an Absurdität grenzt. Die Vereinigten Staaten verteufeln einen Diktator oder eine terroristische Gruppe, haben diese jedoch hinter den Kulissen oft zuvor unterstützt – oder werden dies wieder tun, sobald sich der politische Wind dreht. Saddam Hussein, Verbündeter in den 1980er-Jahren, neuer Hitler im Jahr 1990. Gaddafi, Feind in den 1980er-Jahren, Partner im Krieg gegen den Terror in den 2000er-Jahren, dann Ziel der NATO-Bomben im Jahr 2011. Die Mudschaheddin, Helden gegen die Sowjets, dann Al-Qaida-Terroristen, dann „Rebellen“ in Syrien, unterstützt durch CIA-Pipelines.
Der Verbündete von heute ist der Feind von morgen, und die Opfer sind immer die Menschen vor Ort – diejenigen, die in geheimen Gefängnissen gefoltert, in ihren Häusern bombardiert oder durch Belagerungen und Sanktionen ausgehungert werden. Der Krieg gegen den Terror hat das Feuer des Dschihad nicht gelöscht, sondern mit Benzin übergossen und damit genau den Terror geschaffen, den er zu bekämpfen vorgab.
Jemen: Die vom Menschen verursachte Katastrophe
Wenn Syrien das offensichtlichste Beispiel dafür war, wie die USA und ihre Verbündeten den dschihadistischen Terror angeheizt haben, dann ist der Jemen die schockierendste humanitäre Katastrophe, die direkt von Washington ermöglicht wurde. Jahrzehntelang vor dem saudischen Krieg hatte Washington brutale Diktatoren in Sanaa unterstützt, zuerst Ali Abdullah Saleh und dann seinen Nachfolger Abed Rabbo Mansour Hadi. Saleh, der Jemen mehr als dreißig Jahre lang regierte, war ein Meister der Korruption und Unterdrückung, doch nach dem 11. September wurde er zu einem gefeierten amerikanischen Partner im Krieg gegen den Terror. Er gab grünes Licht für US-Drohnenangriffe, strich Militärhilfe ein und nutzte die Terrorismusbekämpfung als Vorwand, um seine Rivalen im eigenen Land zu vernichten. Seine Herrschaft höhlte Jemen aus, konzentrierte den Reichtum in den Händen seiner Familie und schürte die Ressentiments, die später explodieren sollten.
Als der Arabische Frühling sein Regime erschütterte, orchestrierten Washington und Riad einen Übergang, bei dem Saleh durch Hadi ersetzt wurde, seinen langjährigen Vizepräsidenten und ebenso gefügigen Klienten. Hadi fehlte es an Legitimität, er genoss wenig Unterstützung in der Bevölkerung und wurde weithin als Mann Saudi-Arabiens angesehen. Indem sie sich hinter ihn stellten, verstärkten die USA und ihre Verbündeten die Diktatur und vertieften die Instabilität im Jemen. Dieses Versagen der Regierungsführung öffnete die Tür für den Aufstieg der Huthi-Bewegung, deren Rebellion ihre Wurzeln in der zerrütteten Politik des Jemen hatte und nicht, wie Riad behauptete, in einer Marionettenrolle des Iran.
Als Saudi-Arabien 2015 seinen Krieg zur Zerschlagung der Huthi-Bewegung begann, führte es keinen Verteidigungskrieg, sondern eine aggressive Intervention gegen eines der ärmsten Länder der arabischen Welt. Von Anfang an wurde der Krieg mit völkermörderischen Methoden geführt. Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition bombardierte Märkte, Krankenhäuser, Schulen, Wasseraufbereitungsanlagen und sogar Beerdigungen und Hochzeiten. Streumunition und von den USA gelieferte Bomben verwandelten ganze Dörfer in Schutt und Asche. Häfen wurden blockiert, sodass keine Lebensmittel und Medikamente mehr ins Land gelangen konnten. Bis 2017 hatten sich Hunderttausende mit Cholera infiziert, Millionen waren von Hungersnot bedroht und Kinder hungerten vor aller Augen.
Horton sagt es unverblümt: Dies war ein Krieg der USA, geführt mit amerikanischen Flugzeugen, amerikanischer Munition, amerikanischer Logistik und amerikanischer diplomatischer Deckung. Großbritannien, Frankreich und Australien schlossen sich ebenfalls an und lieferten Waffen, Geheimdienstinformationen und diplomatische Deckung, wodurch sie sich mitschuldig machten an dem, was Experten und Jemeniten selbst weithin als Völkermord bezeichneten. Ohne westliche Unterstützung wäre die saudische Luftwaffe innerhalb weniger Wochen am Boden geblieben. Und es war nicht nur Saudi-Arabien – Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate betrieben geheime Foltergefängnisse im Süden des Jemen und beauftragten Söldner mit der Ermordung politischer Gegner. Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel, angeblich Amerikas gefährlichster terroristischer Feind, gewann in diesem Chaos tatsächlich an Boden und eroberte Städte und Waffen, während Riad und Washington wegschauten. Der Krieg gegen den Terror hatte erneut mehr Terror hervorgebracht, während die wahren Opfer die Kinder des Jemen waren, die in Krankenhäusern ausgemergelt lagen und deren Leben für die strategische Eitelkeit Saudi-Arabiens und der USA geopfert wurde. Das Ergebnis war die größte humanitäre Katastrophe der Welt zu dieser Zeit.
Libyen: Vom Wiederaufbau zum Ruin
Libyen veranschaulicht Hortons These im Kleinen. In den 1980er-Jahren wurde Muammar Gaddafi als Terrorismusunterstützer verteufelt. Nach 2003 wurde er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen und von westlichen Staats- und Regierungschefs dafür gelobt, dass er seine Massenvernichtungswaffenprogramme aufgegeben und bei der Auslieferung und Folterung islamistischer Verdächtiger kooperiert hatte. Dann, im Jahr 2011, mit den Aufständen des Arabischen Frühlings, war er wieder „der tollwütige Hund“, der von NATO-Bomben ins Visier genommen wurde.
Die Intervention wurde als humanitäre Mission zur Verhinderung von Massakern gerechtfertigt. In der Praxis wurde sie jedoch schnell zu einer Operation zum Regimewechsel. NATO-Flugzeuge zerstörten libysche Panzer, Kommandoposten und Gaddafis Konvoi. Der Diktator wurde auf offener Straße gelyncht, seine Leiche geschändet. Hillary Clinton lachte: „Wir kamen, wir sahen, er starb.“ Was folgte, war jedoch keine Demokratie, sondern Anarchie.
Milizen zerteilten das Land, Sklavenmärkte tauchten wieder auf, ISIS errichtete Brückenköpfe in Sirte. Horton unterstreicht die groteske Ironie: Gaddafi hatte gegen Dschihadisten kooperiert und Verdächtige an CIA-Folterer ausgeliefert. Durch seine Ermordung und den Zusammenbruch des Staates öffneten die USA und die NATO Libyen genau den Kräften, die sie angeblich bekämpfen wollten.
Horton unterstreicht, wie westliche Staats- und Regierungschefs den NATO-Krieg rechtfertigten, indem sie Gaddafi vorwarfen, groß angelegte Massaker in Bengasi vorzubereiten – Vorwürfe, die sich später als stark übertrieben erwiesen. Doch während sie vor hypothetischen Gräueltaten warnten, verschlossen Washington und seine Verbündeten die Augen vor sehr realen Verbrechen, die von ihren Partnern vor Ort begangen wurden, darunter die brutale Verfolgung und Ermordung schwarzafrikanischer Migranten und Arbeiter durch die von der NATO unterstützten Rebellen. Der vermeintliche „humanitäre Krieg“ löste somit rassistische Pogrome aus, die der Westen lieber nicht sehen wollte. Die Zerstörung des libyschen Staates führte zu einer Flut von Waffen in Nordafrika und im Nahen Osten, was jihadistische Aufstände von Mali bis Syrien anheizte und einen Kreislauf des Terrors festigte, den die Intervention eigentlich verhindern sollte.
Somalia: Stellvertreterkriege und endlose Drohnen
Somalias Albtraum ist in den westlichen Medien oft unsichtbar, aber Horton ordnet ihn eindeutig in die Liste der Verbrechen des Krieges gegen den Terror ein. Er zeigt, dass Somalias Tragödie nicht mit Al-Qaida begann, sondern mit dem Kalten Krieg, als Washington die brutale Diktatur von Siad Barre bewaffnete und finanzierte. Zwei Jahrzehnte lang regierte Barre mit Folter, Massenmorden und Clan-Favoritismus, während die USA und ihre Verbündeten Waffen lieferten, weil er als Bollwerk gegen den sowjetischen Einfluss am Horn von Afrika galt. Als sein Regime 1991 schließlich zusammenbrach, zerfiel Somalia in einen Krieg der Warlords. Washington verdoppelte seinen Einsatz und unterstützte Barres alte Rivalen in der Ali-Mahdi-Fraktion des Vereinigten Somalischen Kongresses und andere Milizen, Männer, die Zivilisten erpressten und Nahrungsmittelhilfen horteten, während Mogadischu im Chaos versank. Als der mächtigste dieser Kriegsherren, Mohamed Farrah Aidid, sich der amerikanischen Kontrolle widersetzte, ergriffen die US- und UN-Streitkräfte Partei und starteten Razzien gegen seine Anhänger. Horton berichtet, wie im Juli 1993 US-Hubschrauber Hunderte von Somalis in einem Versammlungshaus in Mogadischu massakrierten – eine Gräueltat, die die öffentliche Wut in einen offenen Krieg verwandelte und die Bühne für die berüchtigte Schlacht „Black Hawk Down“ im Oktober desselben Jahres bereitete.
Aus dieser Verwüstung heraus entstand die Union Islamischer Gerichte, eine breite und überwiegend moderate islamistische Bewegung, die schließlich ein gewisses Maß an Stabilität und Entwicklung in Mogadischu wiederherstellte. Ihre Popularität spiegelte das Verlangen der Somalier nach Ordnung nach Jahren der Ausbeutung durch die Kriegsherren wider. Nach dem 11. September 2001 fixierte sich die USA jedoch auf die Vorstellung, dass Al-Qaida in Somalia einen Zufluchtsort finden könnte. Im Jahr 2006 unterstützte Washington Äthiopien, den historischen Erzfeind Somalias, bei der Invasion. Äthiopische Truppen, bewaffnet und unterstützt von den USA, verübten Gräueltaten: Massaker, Gruppenvergewaltigungen und wahllose Beschießungen von Wohngebieten. Die Invasion zerstörte die Union der Islamischen Gerichte und radikalisierte deren Jugendflügel, al-Shabaab, der bald darauf Al-Qaida die Treue schwor.
Auch hier betont Horton das Muster: Bei dem Versuch, den Terrorismus zu beseitigen, haben die USA ihn selbst geschaffen. Al-Shabaab hätte eine unbedeutende Miliz bleiben können, stattdessen wurde sie zu einer regionalen Bedrohung, die Einkaufszentren in Kenia bombardierte und Kindersoldaten rekrutierte. Washington eskalierte daraufhin mit Drohnenangriffen und Razzien der Special Forces, bei denen nicht nur Militante, sondern auch Dorfbewohner, Älteste und Familien getötet wurden. Kenianische Truppen, die sich der Mission der Afrikanischen Union angeschlossen hatten, aber ihre eigenen territorialen Ambitionen verfolgten, plünderten und begingen selbst Übergriffe. Die Bevölkerung Somalias war in einem endlosen Kreislauf aus Besatzung, Aufständen und Luftangriffen gefangen – einem Krieg gegen den Terror, der auf Kosten der Armen geführt wurde.
Pakistan: Das doppelte Spiel und der Drohnenstaat
Pakistan ist eines der eklatantesten Beispiele für Amerikas Abhängigkeit von Diktaturen. Während des gesamten Kalten Krieges und des Krieges gegen den Terror pumpte Washington Milliarden in das Militär Islamabads, während der Geheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI) Dschihadisten beherbergte und bewaffnete. Die Taliban selbst waren eine Schöpfung der pakistanischen Madrassas und Geheimdienste, die Afghanistan beherrschen und Indien den Einfluss verweigern sollten. Selbst als US-Truppen in Helmand gegen Taliban-Kämpfer kämpften, boten pakistanische Zufluchtsorte ihren Anführern in Quetta Schutz. Osama bin Laden selbst wurde in Abbottabad gefunden, nur wenige Gehminuten von einer großen Militärakademie entfernt.
Unterdessen führte die USA einen Drohnenkrieg über den Stammesgebieten Pakistans. „Signature Strikes“ richteten sich gegen Männer, die sich im Freien versammelten, Konvois auf unbefestigten Straßen und Häuser, in denen mutmaßliche Militante untergebracht waren. Ganze Hochzeitsgesellschaften wurden ausgelöscht, Kinder, die Feuerholz sammelten, wurden in Stücke gerissen. Die Angriffe versetzten ganze Regionen in Angst und Schrecken – Eltern hielten ihre Kinder von der Schule fern, wenn es am Himmel brummte. Die pakistanischen Diktaturen – zuerst Pervez Musharraf, dann die vom Militär dominierten Regierungen – ermöglichten die Angriffe, während sie sie öffentlich verurteilten, und spielten so auf beiden Seiten, um die US-Finanzierung aufrechtzuerhalten. Die einfachen Pakistaner zahlten den Preis: Hunderte von Zivilisten wurden heimlich und ohne Gerichtsverfahren getötet, ihre Namen waren selbst den Amerikanern unbekannt, die ihren Tod angeordnet hatten.
Horton merkt an, dass die von Washington finanzierten pakistanischen Militäroffensiven nicht gegen die afghanische Taliban-Führung gerichtet waren, die weiterhin geschützt blieb, sondern gegen die pakistanische Taliban (TTP) und andere lokale Militante in Waziristan und im Swat-Tal. Diese Kampagnen basierten auf einer Taktik der verbrannten Erde – wahllose Beschießungen, Luftangriffe und kollektive Bestrafungen –, die Tausende von Zivilisten tötete und Millionen vertrieb. Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, ganze Bevölkerungsgruppen entwurzelt und die Zurückgebliebenen terrorisiert.
Die westliche Allianz mit autoritären Regimes
Horton betont, dass der Krieg der USA gegen den Terror über die zentralen Kriegsgebiete Irak, Afghanistan und Jemen hinaus stets auf Allianzen mit einigen der repressivsten Regime der Welt beruhte. Jahrzehntelang bewaffneten und finanzierten Washington und seine westlichen Verbündeten die Diktaturen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und anderer arabischer Golfstaaten, Ägyptens, Jordaniens und Tunesiens – um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen –, trotz ihrer Geschichte von Folter, Zensur und der Unterdrückung abweichender Meinungen. Diese Regime stellten Stützpunkte, Geheimdienstinformationen und politische Deckung für die Kriege der USA zur Verfügung, während sie ihre eigene Bevölkerung auf eine Weise unterdrückten, die genau den Extremismus hervorbrachte, den Washington angeblich bekämpfte. Horton betont, dass dies kein Nebeneffekt war, sondern die eigentliche Logik der amerikanischen Strategie: Die Stabilität des Imperiums wurde erkauft, indem Millionen Menschen unter autoritärer Herrschaft gehalten wurden. Tatsächlich unterstützte der Westen die große Mehrheit der Diktaturen im Nahen und Mittleren Osten.
Er betont auch, dass die militärische Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel als Teil desselben Systems betrachtet werden muss. Die Milliarden an US-Hilfsgeldern und Waffen, die die Besetzung aufrechterhalten, die Belagerung des Gazastreifens und die wiederholten Bombardierungen des Libanon und anderer Nationen haben Generationen radikalisiert und den Rekrutierern der Dschihadisten eine ständige Quelle von Missständen geliefert, die sie ausnutzen können.
Folter und der Archipel des Grauens
Durch alle Schauplätze zog sich die Architektur der Folter. Horton lässt die Leser dies nicht vergessen. Von Bagram bis Abu Ghraib, von Guantánamo bis zu den geheimen CIA-Gefängnissen in Polen, Rumänien und Thailand institutionalisierte der Krieg gegen den Terror Praktiken, die einst strafbare Verbrechen waren. Das außerordentliche Auslieferungsprogramm der CIA lieferte Gefangene nach Ägypten, Syrien, Jordanien und Marokko, wo verbündete Geheimpolizeien Elektroschocks, Vergewaltigungen und Scheinhinrichtungen praktizierten. Weit davon entfernt, nur ein paar „schwarze Schafe“ zu sein, wurde Folter institutionalisiert, von Anwälten in Washington überwacht und von Auftragnehmern und Spezialeinheiten vor Ort durchgeführt. Männer wurden mit Waterboarding bis zum Erbrechen gefoltert, tagelang unter blendendem Licht wach gehalten, entkleidet und gedemütigt, mit Fremdkörpern vergewaltigt, an Decken gekettet oder dem Erfrieren überlassen. „Verstärkte Verhörmethoden“ war der Euphemismus, aber in Wirklichkeit handelte es sich um Sadismus, der von Anwälten kodifiziert und von Bürokraten beschönigt wurde.
Das Ergebnis der Folter waren keine Wahrheiten, sondern falsche Geständnisse. Sie nährte die Lügen über Saddams angebliche Massenvernichtungswaffen und Verbindungen zu Al-Qaida. Sie zerstörte Leben und Psychen. Und sie verkündete der Welt, dass Amerikas Krieg für die „Freiheit“ auf den ältesten Instrumenten der Tyrannei beruhte. Horton betont: Dies war nicht das Werk einzelner skrupelloser Agenten. Es war Politik, die auf höchster Ebene gebilligt wurde und bis heute ungestraft bleibt.
Sanktionen: Kollektivstrafe als Politik
Selbst wenn keine Bomben fielen, dienten Sanktionen als Waffen. Der Irak in den 1990er-Jahren war der Prototyp, aber das Muster weitete sich auf den Iran, Syrien und darüber hinaus aus. Lebenswichtige Medikamente, Industrieteile und sogar Lebensmittel wurden beschränkt. Horton betont unerbittlich die menschlichen Opfer: Kindern wurde die Chemotherapie verweigert, Krankenhäuser hatten keinen Strom, Eltern konnten ihre Familien nicht ernähren. Sanktionen wurden als „intelligente“ Instrumente verkauft, aber in der Praxis trafen sie die Schwachen, während die Eliten Wege fanden, sie zu umgehen. Sie waren Belagerungskriege unter einem anderen Namen, Instrumente der Grausamkeit, die sich als Diplomatie tarnten.
Fazit: Der Krieg gegen den Terror
Was Horton in „Enough Already“ leistet, ist mehr als eine Geschichte der Kriege nach dem 11. September. Es ist eine Demontage des zentralen Mythos, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten für Sicherheit und Demokratie gekämpft hätten. In einem Fall nach dem anderen – Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen, Libyen, Somalia, Pakistan – zeigt er das Gegenteil. Die USA kämpften nicht, um den Terror zu beenden, sondern um ihn neu zu konfigurieren, ihn zu nutzen, ihn zu erzeugen. Unsere Verbündeten vor Ort waren fast immer Diktaturen oder Milizen – Männer, die ungestraft folterten, vergewaltigten und mordeten. Unsere Methoden – Städte bombardieren, Gefangene foltern, Bevölkerungen hungern lassen – unterschieden sich nicht von den Übeln, die wir angeblich bekämpften.
Die menschlichen und finanziellen Kosten sind erschütternd. Horton zitiert Untersuchungen, wonach diese Kriege mindestens 6,4 Billionen Dollar gekostet haben – Geld, das zum Wiederaufbau der amerikanischen Gesellschaft hätte verwendet werden können, stattdessen aber für Zerstörungen im Ausland ausgegeben wurde. Die direkte Zahl der Todesopfer an allen Fronten des Krieges gegen den Terror beträgt mindestens zwei Millionen Menschen – eine Zahl, die noch viel höher ausfällt, wenn man die indirekten Opfer von Hunger, Krankheiten und zusammenbrechender Infrastruktur miteinbezieht. Inzwischen wurden mindestens 37 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, was zu Flüchtlingskrisen von Afghanistan bis Libyen geführt hat. Das sind keine abstrakten Zahlen: Sie stehen für Millionen zerstörter Leben, ganze Gesellschaften, die auseinandergerissen wurden, und Generationen, die zu Trauma und Exil verdammt sind. Horton zwingt die Leser, sich mit dieser erschütternden Arithmetik des Imperiums auseinanderzusetzen.
Der Krieg gegen den Terror war das größte Eigentor des 21. Jahrhunderts. Er hat Millionen Menschen getötet, Millionen vertrieben, ganze Gesellschaften zerstört und genau die dschihadistischen Bewegungen hervorgebracht, die er zu vernichten suchte. Er hat unsere erklärten Werte verraten und die internationale Ordnung entstellt. Und doch war es, wie Horton zeigt, keine Reihe von Fehlern – es war die Logik des Imperiums, in der Menschenleben entbehrlich sind, in der Verbündete und Feinde über Nacht die Plätze tauschen können und in der sich der Kreislauf der Gewalt endlos fortsetzt.
Am Ende von „Enough Already“ ist eine Schlussfolgerung unvermeidlich: Die wahren Kriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts sitzen nicht in Höhlen in Tora Bora, sondern in den polierten Büros von Washington, London und Riad. Der Krieg gegen den Terror war ein Krieg der Wahl, ein Krieg der Lügen und vor allem ein Krieg für den Terror. Um ihn zu verstehen, muss man nicht nur die jüngste Geschichte Revue passieren lassen, sondern sich auch mit der blutigen Architektur unserer heutigen Welt auseinandersetzen.
Titelbild: Buckdeckel “Enough Already”